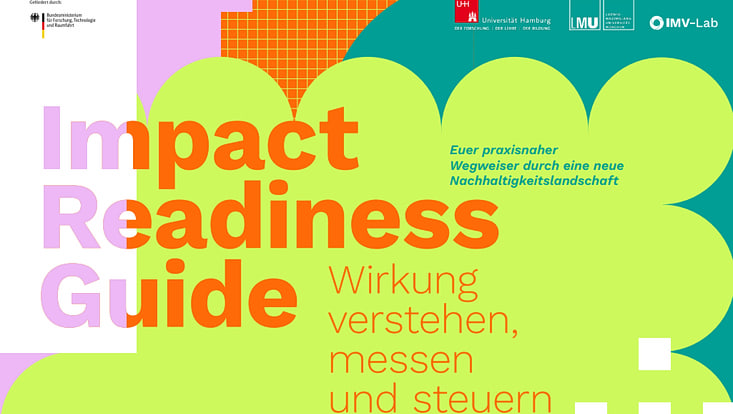Kurz und knapp
20. Dezember 2022

Foto: UHH
+++ Projekt SocialMediaHistory: Sorge um Quellen und Tagungsbericht +++ Verleihung des Kurt-Hartwig-Siemers-Wissenschaftspreises 2022 an PD Dr. Konrad Duden +++ Publikation „100 Jahre Universität Hamburg“: Dritter Band erschienen +++ Deutscher Studienpreis 2022 für Juristin Kim Teppe +++ „Hamburg Airport. Bewegt. Nachbarschaftspreis“ für Refugee Law Clinic +++ BWL-Fakultät: Neue Jobbörse für Studierende und Wissenschaftliche Mitarbeitende +++ Stipendien für geflüchtete Studierende und Forschende aus der Ukraine +++ Vortragsreihe „Wenn Gravitationskraft auf Quantenphysik trifft“ +++ 3. Februar 2023: PhD Day an der Uni Groningen +++ Neuer Dekan und neue Prodekaninnen an der Fakultät für Betriebswirtschaft +++
Projekt SocialMediaHistory: Sorge um Quellen und Tagungsbericht
20. Dezember. Was passiert mit Twitter, wenn immer mehr Nutzerinnen und Nutzer die Plattform verlassen? Darum machen sich die Forschenden des Projekts SocialMediaHistory in einem aktuellen Beitrag Gedanken. Bei der Online-Tagung „#History on Social Media – Sources, Methods, Ethics“ diskutierten zudem erstmals Expertinnen und Experten aus vier Kontinenten über zeitgemäße Arbeitsweisen und Fragestellungen der historischen Forschung über und mit Sozialen Medien. Die Videos der Konferenzvorträge sind auf der Website des Projekts zu finden.
+++
Verleihung des Kurt-Hartwig-Siemers-Wissenschaftspreises 2022 an PD Dr. Konrad Duden

15. Dezember. Der Jurist PD Dr. Konrad Duden hat am 14. Dezember für seine an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg verfasste Habilitation den Kurt-Hartwig-Siemers-Wissenschaftspreis 2022 erhalten. Bei der feierlichen Festveranstaltung in der Handelskammer Hamburg war auch Universitätspräsident Prof. Dr. Hauke Heekeren anwesend. Den mit 30.000 Euro dotierten Preis, den die Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung in Kooperation mit der Edmund Siemers-Stiftung vergibt, erhält Duden für seine Arbeit über „Digitale Sachherrschaft“. Er zeigt auf, mit welchen neuen Herausforderungen die Rechtsordnung durch die Digitalisierung konfrontiert wird. So könnten etwa Hersteller von vernetzten Fahrzeugen und Smart-Home-Anwendungen diese einseitig und gegen den Willen der Nutzerinnen und Nutzer abschalten, während die Anwenderinnen und Anwender dagegen nur lückenhaft geschützt seien.
+++
Publikation „100 Jahre Universität Hamburg“: Dritter Band erschienen
14. Dezember. 2019 feierte die Universität Hamburg ihren 100. Geburtstag. Zu diesem Anlass startete die Arbeit an einer mehrbändigen Publikation, die sich multiperspektivisch mit der Geschichte der Universität auseinandersetzt und an der rund 100 Autorinnen und Autoren beteiligt sind. Der nun im Wallstein Verlag erschienene dritte Band widmet sich mit Beiträgen der Geschichte der Erziehungswissenschaft, der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie der Rechtswissenschaft an der Universität. Nachdem Band 1 (2020) allgemeine Aspekte und Entwicklungen behandelt hatte, enthalten die weiteren drei Bände Beiträge zu einzelnen Fächern und Instituten. Band 4 mit Beiträgen zu den Naturwissenschaften und zur Medizin ist für 2023 avisiert.
+++
Deutscher Studienpreis 2022 für Juristin Kim Teppe
13. Dezember. Betriebsgeheimnis vs. Umweltschutz: Mensch und Tier scheiden bis zu 90 Prozent von konsumierten Arzneimitteln wieder aus. Wie diese Arzneimittelrückstände in der Umwelt wirken, ist weder der Öffentlichkeit noch den Behörden hinreichend bekannt – die Hersteller berufen sich auf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. In ihrer rechtswissenschaftlichen Dissertation zeigt Kim Teppe (geb. Oelkers), dass so ein effektiver Umweltschutz verhindert wird. Dafür wurde sie jetzt von der Körber-Stiftung mit einem Spitzenpreis des Deutschen Studienpreises geehrt.
Der Preis ist mit jeweils 25.000 Euro dotiert. Mit ihm zeichnet die Körber-Stiftung exzellente Dissertationen aller Fachrichtungen aus, die eine besonders hohe gesellschaftliche Relevanz haben. Die beiden anderen Spitzenpreise erhielten der Chemiker Manuel Häußler von der Universität Konstanz und der Wirtschaftsingenieur Lars Nolting von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Der Deutsche Studienpreis der Körber-Stiftung zählt zu den höchstdotierten wissenschaftlichen Nachwuchspreisen in Deutschland.
+++
„Hamburg Airport. Bewegt. Nachbarschaftspreis“ für Refugee Law Clinic
12. Dezember. Beim vierten „Hamburg Airport. Bewegt. Nachbarschaftspreis“ hat die Refugee Law Clinic (RLC) der Fakultät für Rechtswissenschaft in der Kategorie Gesellschaft & Soziales die meisten Stimmen erhalten. Der mit 1.500 Euro dotierte Preis würdigt das Projekt „Abschiebehaftberatung“ der RLC Hamburg und der Bucerius Law School. Anna Gleiser und Hannah Franz, wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Gabriele Margarete Buchholtz, nahmen die Auszeichnung stellvertretend für die RLC entgegen. Menschen, die von Abschiebehaft betroffen sind, können sich kostenlos von Jura- oder Sozialwissenschafts-Studierenden verschiedener Hochschulen und Universitäten beraten und beim Prozess vertreten lassen.
Bei einem Online-Voting hatten mehr als 16.600 Menschen über die 71 Projekte, die sich beworben hatten, abgestimmt. Insgesamt 12 Projekte wurden ausgezeichnet.
+++
BWL-Fakultät: Neue Jobbörse für Studierende und Wissenschaftliche Mitarbeitende
7. Dezember. Die Fakultät für Betriebswirtschaft stellt eine zentrale Jobbörse zur Verfügung. Sie ist Teil einer Plattform, die von der gemeinnützigen „European Foundation for Management Development“ betrieben wird, und bietet insbesondere Studierenden dieser Fakultät Stellen- und Praktika-Angebote – sowohl an der Universität als auch in Unternehmen in Hamburg, Deutschland und ganz Europa. Zudem gibt es auf der Seite viele Informationen und Unterstützung für Bewerbung und Karriereplanung. Unternehmen, die Jobs, Werkstudierendenstellen oder Praktika anbieten möchten, können die relevanten Links oder PDFs per Mail an die Fakultät(jobboerse.bwl"AT"uni-hamburg.de) senden.
+++
Stipendien für geflüchtete Studierende und Forschende aus der Ukraine
6. Dezember. Aus Mitteln des DAAD-Stipendienprogramms „Zukunft Ukraine“ und aus Mitteln der Joachim Herz Stiftung fördert die Universität Hamburg die akademische Ausbildung ukrainischer Studierender, die ihr Heimatland aufgrund des Kriegs verlassen mussten. Ziel des Programms ist die Unterstützung der Ukraine durch einen langfristigen und nachhaltigen Beitrag zur Qualifikation von ukrainischen Studierenden an der Universität Hamburg. Noch bis zum 15. Dezember sind Bewerbungen möglich. Alle Informationen unter: https://www.uni-hamburg.de/internationales/studierende/incoming/studium-mit-abschluss/waehrend-des-studiums/finanzierung/stipendien-ukraine.html
Die Joachim Herz Stiftung stellt ebenfalls zusätzliche Mittel für die Förderung ukrainischer Forschender zur Verfügung, die einen Forschungsaufenthalt an einer der staatlichen Hamburger Hochschulen durchführen: https://www.uni-hamburg.de/internationales/mitarbeitende/mitarbeitende-wissenschaft/gefaehrdete-forschende/funding/hpsar-ukraine.html
+++
Vortragsreihe „Wenn Gravitationskraft auf Quantenphysik trifft“
6. Dezember. Schwarze Löcher, quantengequetschtes Laserlicht, Gravitationswellen – es gibt Bereiche, wo Gravitation und Quantenphysik zusammenwirken. Was es damit genau auf sich hat, wird jetzt in einer Vortragsreihe der Akademie der Wissenschaften in Hamburg (AWH) in Kooperation mit dem Hamburger Planetarium vorgestellt. Bei den Vorlesungen „Wenn Gravitationskraft auf Quantenphysik trifft“ halten im Dezember 2022 und im Februar 2023 Experten im Planetarium Hamburg Vorträge zu ihren Spezialgebieten. Dabei sind auch Prof. Dr. Roman Schnabel vom Institut für Laserphysik und Juniorprof. Dr. Oliver Gerberding vom Institut für Experimentalphysik der Universität Hamburg. Die Termine und weitere Informationen gibt es auf der Webseite der AWH.
+++
3. Februar 2023: PhD Day an der Uni Groningen
5. Dezember. Am 3. Februar 2023 gibt es eine tolle Gelegenheit, um sich international zu vernetzen und mit anderen Promovierenden auszutauschen: dann findet der PhD Day an der Uni Groningen statt. Die Reichsuniversität Groningen und die Universität Hamburg verbindet neben zahlreichen wissenschaftlichen Kontakten auch eine strategische Partnerschaft. Promovierende aus Hamburg können aufgrund einer Kooperation mit der Universität Hamburg und der Hamburg Research Academy (HRA) am PhD Day teilnehmen. Die Veranstaltung bietet spannende Keynotes, Workshops, Podiumsdiskussionen, eine Karrieremesse und jede Menge Möglichkeiten für den persönlichen Austausch. Und das Besondere: Die Veranstaltung wird von Promovierenden selbst auf die Beine gestellt. Infos zu Anmeldung, Programm und Tickets gibt es auf der Webseite.
+++
Neuer Dekan und neue Prodekaninnen an der Fakultät für Betriebswirtschaft
1. Dezember. Mit Monatsbeginn gibt es im Dekanat der Fakultät für Betriebswirtschaft drei personelle Änderungen: Prof. Dr. Henrik Sattler ist neuer Dekan der Fakultät, Prof. Dr. Nicole V. S. Ratzinger-Sakel tritt das Amt der Prodekanin für Forschung und Nachwuchsförderung an und Prof. Dr. Dorothea Alewell ist neue Prodekanin für Studium und Lehre. Gemeinsam mit dem vorherigen Dekan, Prof. Dr. Stefan Voß, der weiter als Prodekan tätig ist, bilden sie das Gremium, das verantwortlich ist für die Verwaltung und Leitung der Fakultät – einschließlich der Verteilung und Verwendung des Fakultätsbudgets. Unterstützt wird das Dekanat von Verwaltungsleiter Dr. Ferdinand Wenzlaff und fünf Professorinnen und Professoren, die mit spezifischen administrativen Themen der Fakultät beauftragt sind.
+++
Archiv 2022
Kurzmeldungen Januar 2022
KWiK-Schulstudie: Lehrkräfte nutzen mehr Fortbildungen zu digitalen Themen +++ Lehrforschungsprojekt: Auswirkungen des digitalen Studiums auf die Lebenssituation der Studierenden der Sport- und Bewegungswissenschaft +++ Podcast über die Hamburger Klimaforschung +++ Wissenschaftsjahr 2022: „IdeenLauf“ startet und UHH-Mitglieder in Gremien berufen +++
KWiK-Schulstudie: Lehrkräfte nutzen mehr Fortbildungen zu digitalen Themen
28. Januar. Schließungen, Distanzunterricht und Unsicherheit – die Pandemie stellt die Schulen vor riesige Herausforderungen und richtet ein Brennglas auf Problembereiche wie Chancengleichheit und Digitalisierung. Die Studie „Kontinuität und Wandel der Schule in Krisenzeiten“ (KWiK) – ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Hamburg, des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) und der „International Association for the Evaluation of Educational Achievement“ (IEA) – untersucht die Auswirkungen der Ausnahmesituation. Im Sommer vergangenen Jahres haben 260 Schulen an der zweiten Befragungswelle teilgenommen, wobei erstmal auch Lehrerinnen und Lehrer einbezogen wurden.
Ein erstes Ergebnis: Sowohl Lehrkräfte als auch Schulleitungen gaben an, dass die Nutzung von Fortbildungsangeboten im Bereich Digitalisierung stark zugenommen hat, etwa zu dialogischen Formaten für Lehren und Lernen auf Distanz und zu Anwendungsprogrammen. Allerdings wurde gleichzeitig eine deutlich geringere Teilnahme an Fortbildungen zu Fördermaßnamen für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler oder zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit psychischen Schwierigkeiten verzeichnet. Bereits vor der Pandemie wurden Schulungen zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die einen besonderen Förderbedarf haben, sehr wenig in Anspruch genommen. Da nach bisherigen Erkenntnissen die ohnehin schon leistungsschwächeren oder aus anderen Gründen benachteiligten Kinder und Jugendlichen besonders unter den pandemiebedingten Einschränkungen leiden, sehen die Forschenden Handlungsbedarf.
„Wir verbinden mit der KWiK-Studie die Hoffnung, gute Ideen und kreative Lösungen freizulegen, die Schulen zur Bewältigung der pandemiebedingten Krise gefunden haben, und diese dann weiterzugeben. Besonders wichtig sind uns dabei Lösungen, die dabei helfen, dass benachteiligte Schülerinnen und Schüler nicht verlorengehen. Wie wichtig dies für das Wohlergehen einer Gesellschaft ist, zeigen auch viele internationale Studien“, so Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ingrid Gogolin von der Universität Hamburg. Eine Übersicht der Zwischenergebnisse ist online auf der Seite der IEA abrufbar.
+++
Lehrforschungsprojekt: Auswirkungen des digitalen Studiums auf die Lebenssituation der Studierenden der Sport- und Bewegungswissenschaft
28. Januar. Die Corona-Pandemie hat zu mehreren digitalen oder zumindest hybriden Semestern geführt; erst in den vergangenen Monaten ist etwas mehr Präsenz möglich. Die Veränderungen waren für alle Studierenden groß, aber die Studierenden am Institut für Bewegungswissenschaft waren mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, da das Studium einen besonders hohen Praxisanteil aufweist. In einem von der Claussen-Simon-Stiftung unterstützten Lehrforschungsprojekt haben Wissenschaftlerinnen des Arbeitsbereichs „Kultur, Medien und Gesellschaft“ gemeinsam mit Studierenden die Situation im Sommersemester 2021 untersucht. Im Fokus standen vor allem die sozialen Aspekte der neuen Studienbedingungen sowie die Lebenssituationen der Studierenden. Neben einer quantitativen Fragebogen-Erhebung wurden auch Beobachtungsprotokolle und Videoanalysen ausgewertet. Unter der Leitfrage, ob die pandemiebedingten Kontakteinschränkungen und die Digitalisierung der Lehre weitere Tendenzen sowohl von Individualisierung als auch von einer Enttraditionalisierung der Universität als Institution bewirkt haben, wurden fünf Dimensionen betrachtet: „Bewegungs- und Sportpraxis“, „Wohnsituation“, „Studiensituation“, „Campus-Leben und Studienstadt“ sowie „privates soziales Umfeld“. Die Ergebnisse wurden in einem Beitrag der Zeitschrift „Sport und Gesellschaft“ veröffentlicht.
+++
Podcast über die Hamburger Klimaforschung
13. Januar. In der aktuellen Folge der Podcast-Reihe „Exzellent erklärt“ wird diesmal der Exzellenzcluster Climate, Climatic Change, and Society (CLICCS) an der Universität Hamburg vorgestellt. Unter dem Titel „Klimaforschung – Sind 1,5 Grad noch plausibel?“ sprechen Prof. Dr. Anita Engels und Dr. Christopher Hedemann über die gesellschaftlichen Schlüsselfaktoren, die den Klimaschutz hemmen oder befördern können.
Die Podcast-Reihe wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert, jedes der 57 deutschen Exzellenzcluster wird vorgestellt. Mehr dazu finden Sie auf der Website des Exzellenclusters CLICCS.
+ + +
Wissenschaftsjahr 2022: „IdeenLauf“ startet und UHH-Mitglieder in Gremien berufen
11. Januar. Das Wissenschaftsjahr 2022 steht unter dem Motto „Nachgefragt!“. Ob zu Zielen, Prozessen und Forschungsthemen – Bürgerinnen und Bürger sind deutschlandweit aufgerufen, ihre Fragen an die Wissenschaft zu formulieren. Herzstück der Aktion ist der sogenannte „IdeenLauf“, bei dem Anregungen und Fragen vom 14. Januar bis zum 15. April 2022 online eingereicht werden können. Danach werden die Fragen fünf großen Themengebiete wie „Umwelt, Klima, Erde, Universum“ oder „Innovation, Technik, Arbeit“ zugeordnet und im Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft diskutiert, gebündelt und ergänzt. Der Prozess wird von einem Citizen Panel mit 30 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern sowie einem Science Panel aus 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begleitet. Für das Science Panel wurden von der Universität Hamburg Prof. Dr. Jetta Frost, Betriebswirtin und UHH-Vizepräsidentin für Transfer, sowie der Historiker und Citizen-Science-Spezialist Prof. Dr. Thorsten Logge berufen. Im Themenbereich „Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Sicherheit“ wird zudem Dr. Ali Gümüsay, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Sozialökonomie, der Fachjury angehören, die die eingereichten Fragen und Themen weiterbearbeitet. Das Wissenschaftsjahr ist eine seit 2000 bestehende Kooperation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Initiative „Wissenschaft im Dialog“. Vorbild für den „IdeenLauf“ ist unter anderem das niederländische Projekt „Dutch Research Agenda“ mit fast 12.000 eingereichten Fragen aus der Bevölkerung.
+++
Kurzmeldungen Februar 2022
+++ EW-Podcast „Bildungsschnack“: Jetzt auch über Spotify und iTunes +++ Corona-Kidditorial gemeinsam mit Illustrator Axel Scheffler +++ Sportpark Rothenbaum nach Sturmschaden gesperrt +++ Wissenschaftsplattform Klimaschutz veröffentlicht Jahresgutachten unter Beteiligung der Universität Hamburg +++ Refugee Law Clinic: Workshops zum Thema Migrationsrecht +++ „POEM“: Projekt zur Erinnerungskultur endet mit öffentlicher Abschlusskonferenz +++ „Young Climate Scientists Award“: Junge Talente aus der Klimaforschung gesucht +++ Neue Skulptur im Botanischen Garten erinnert an Wissenschaftsmäzen Max Emden +++ Neue Studie zur Familienfreundlichkeit der Hamburger Hochschulen +++
EW-Podcast „Bildungsschnack“: Jetzt auch über Spotify und iTunes
23. Februar. Im Podcast „Bildungsschnack“ der Fakultät für Erziehungswissenschaft wird jeden Monat ein Forschungsprojekt vorgestellt. Im Gespräch berichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihrer Motivation, ihrer Arbeitsweise und der Relevanz ihrer Ergebnisse für die Praxis. Und ab jetzt können die Folgen auch über Spotify und iTunes abonniert werden. So bekommen die Hörerinnen und Hörer im Februar zum Beispiel Einblick in das Projekt „CoMMiTEd“, das vom Programm „ERASMUS+“ gefördert wird. Hier geht es darum, wie in Fake News Verbindungen zwischen Covid-19 und Minderheiten hergestellt werden sowie um die Frage, wie Schülerinnen und Schüler diese Informationen konsumieren und weitergeben bzw. teilen. Prof. Dr. Silvia Melo-Pfeifer und Franziska Gerwers aus dem Arbeitsbereich „Didaktik der romanischen Sprachen“ berichten unter anderem, wie das Thema in den Unterricht integriert werden kann und stellen eine Datenbank vor, die im Rahmen des Projektes für die Nutzung in Schulen entsteht und in der verschiedene Fake News gesammelt und widerlegt werden. Alle Informationen gibt es auch auf der Webseite zur Podcast-Folge.
+++
Corona-Kidditorial gemeinsam mit Illustrator Axel Scheffler
21. Februar. Was ist ein Virus? Was ist eine Pandemie? Und wieso mussten wir plötzlich alle zuhause bleiben? Um sich mit Themen rund um die Corona-Pandemie aus der Perspektive von Kindern auseinanderzusetzen, haben die Universität Hamburg und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gemeinsam mit Axel Scheffler, dem international bekannten Illustrator des „Grüffelo“, eine neue Form der interaktiven digitalen Online-Ausstellung entwickelt: das Kidditorial.
Mit Hilfe der Illustrationen im Kidditorial sollen Fragen zur Pandemie sowie zu Infektionen im Allgemeinen unter dem Motto „Miteinander, füreinander, schützen wir einander!“ kindgerecht erklärt werden. „Das Kidditorial entstand aus dem Wunsch, Kinder und Eltern während und nach der Pandemie zu erreichen und Online-Inhalte mit Axel Schefflers allzu menschlichen Zeichnungen zu vermitteln, die die prägenden Erfahrungen und Erinnerungen der Kinder an die Krise widerspiegeln und ihnen neue Informationen zur Verfügung stellen und hoffentlich auch Freude bereiten“, erklären Prof. Dr. Blanche Schwappach-Pignataro, Dekanin und Vorstandsmitglied des UKE, sowie Prof. Dr. Ulf Schmidt, Fachbereich Neuere Geschichte an der Universität Hamburg. Im Medizinhistorischen Museum am UKE gibt es parallel zur Sonderausstellung „Pandemie. Rückblicke in die Gegenwart“ auch Zeichnungen von Axel Scheffler zu bestaunen. Das Kidditorial ist online verfügbar unter: kidditorial.de
+++
Sportpark Rothenbaum nach Sturmschaden gesperrt
21. Februar. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat der Sturm das Dach der beiden oberen Hallen am Sportpark Rothenbaum abgedeckt und weitere Schäden am Gebäude verursacht. Das komplette Gebäude wurde von der Polizei gesperrt. Daher können dort am heutigen Montag, 21. Februar, keine Kurse stattfinden und auch der Studio-Betrieb ist erst einmal nicht möglich. Aufgrund der unklaren Lage, wird auch der für heute geplante Buchungsstart für das Kursangebot im März verschoben.
Aktuelle Information sind auf den Seiten des Hochschulsport Hamburg zu finden.
+++
Wissenschaftsplattform Klimaschutz veröffentlicht Jahresgutachten unter Beteiligung der Universität Hamburg
18. Februar. Wie kann die deutsche und europäische Klimaschutzpolitik der Zukunft aussehen? Die Wissenschaftsplattform Klimaschutz hat der Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger ein Gutachten mit Handlungsempfehlungen übergeben, das diese Frage aus wissenschaftlicher Sicht beantwortet.
Das Papier mit dem Titel „Auf dem Weg zur Klimaneutralität: Umsetzung des European Green Deal und Reform der Klimapolitik in Deutschland“ unterstützt die Bundesregierung dabei, die Klimaschutzpolitik auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse umzusetzen und weiterzuentwickeln. Neben der Ausgestaltung der europäischen und deutschen Klimaschutz-Governance werden auch die Förderung von Schlüsseltechnologien für die Klimaneutralität sowie die Resonanzfähigkeit von Klimapolitik im Gutachten thematisiert.
Die Wissenschaftsplattform Klimaschutz ist ein Expertengremium, das 2019 von der Bundesregierung eingerichtet wurde. Teil des achtköpfigen Teams sind Prof. Dr. Anita Engels und Prof. Dr. Timo Busch vom Exzellenzcluster CLICCS, die die wissenschaftliche Expertise der Universität Hamburg in das Gutachten eingebracht haben.
Mehr Informationen zum Jahresgutachten und den Handlungsempfehlungen sind auf der Seite des Exzellenzclusters nachzulesen.
+++
Refugee Law Clinic: Workshops zum Thema Migrationsrecht
17. Februar. Im Vorfeld des migrationsrechtlichen Moot Courts, der im Mai 2022 an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg stattfindet, organisiert die Refugee Law Clinic – ein studentisch initiiertes Projekt der Uni – mehrere Veranstaltungen und Workshops rund um den Bereich Migrationsrecht. Diese Angebote wenden sich nicht nur an Studierende der Rechtswissenschaften, sondern sprechen ganz unterschiedliche Disziplinen an. Am 24. Februar 2022 (18 Uhr, via Zoom) geht es um das Thema „(Un-)recht an den EU-Außengrenzen“. Neben Vorträgen von Expertinnen und Experten soll gemeinsam über die Rolle von zivilgesellschaftlichen und rechtlichen Interventionen im Kontext von staatlicher Grenzgewalt gegenüber Migrantinnen und Migranten diskutiert werden. Am 9. März 2022 (ebenfalls 18 Uhr, via Zoom) lautet das Thema „Trauma und Flucht – Psychologie meets Jura“. Im Fokus stehen die Folgen des Verlusts der Heimat, der Fluchterfahrungen sowie traumatischer Erlebnisse auf die menschliche Psyche und den Körper. Die Anmeldung erfolgt jeweils online, die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Informationen zur Refugee Law Clinic, den Angeboten und Workshops gibt es auf der Webseite des Projektes.
+++
„POEM“: Projekt zur Erinnerungskultur endet mit öffentlicher Abschlusskonferenz
11. Februar. Wie erinnern wir uns, einzeln und als Kollektiv? Was ist privat, was öffentlich? Und welche Rolle spielt die Digitalisierung? Mit diesen und anderen Fragen rund um die Kultur des Erinnerns haben sich drei Jahre lang 13 Forscherinnen und Forscher – vorrangig Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler – in ihren Projekten beschäftigt. In einem EU-geförderten sogenannten European Training Network arbeiteten sie dabei international und interdisziplinär zusammen und kooperierten eng mit der Praxis. Ihre Forschungsergebnisse präsentieren sie am 4. und 5. März 2022 bei der öffentlichen, online stattfindenden Abschlusskonferenz „Futures of Participatory Memory Work“. Hier können sich Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft, der Erinnerungspraxis aus Gesellschaft und Kultur, aber auch der interessierten Öffentlichkeit über neue Ansätze für die Praxis informieren. Die Impulse sollen zukünftig in eine sogenannte „Community of Practice“ einfließen und weiterentwickelt werden. Dieses Forum für Stakeholder aus unterschiedlichen Praxisfeldern wird bei der Konferenz starten. Alle Informationen zur kostenlosen Teilnahme (Registrierung bis zum 1. März 2022) und zum Programm gibt es auf der Konferenzwebseite.
+++
„Young Climate Scientists Award“: Junge Talente aus der Klimaforschung gesucht
7. Februar. Die Studierenden von heute sind die Klimaforschenden von morgen und leisten oft schon in ihren Abschlussarbeiten wichtige Beiträge zur Lösung der drängenden Fragen zu globaler Erwärmung und Klimawandel. Das Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) der Universität Hamburg schreibt nun zum zweiten Mal den „Young Climate Scientists Award“ aus, um besonders gelungene Bachelor- und Master-Arbeiten, die sich mit Klimathemen beschäftigen, auszuzeichnen. Dies können naturwissenschaftliche Arbeiten ebenso sein wie Arbeiten aus den Sozialwissenschaften, der Ökonomie und den Geisteswissenschaften. Voraussetzung ist allerdings, dass sie an der Universität Hamburg verfasst wurden. Der 1. Preis ist mit 5.000, der 2. Preis mit 3.000 und der 3. Platz mit 2.000 Euro dotiert. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 31. März 2022. Alle Informationen zum Bewerbungsprozess und den Voraussetzungen gibt es auf der Ausschreibungswebseite.
+++
Neue Skulptur im Botanischen Garten erinnert an Wissenschaftsmäzen Max Emden
4. Februar. Max Emden (1874–1940) entstammte einer der ältesten jüdischen Hamburger Kaufmannsfamilien, er schuf ein Kaufhaus-Imperium und förderte mit seinem Vermögen zahlreiche Projekte und Einrichtungen in seiner Heimatstadt. Unter anderem war er Mitbegründer der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung und damit Wegbereiter der Universitätsgründung 1919. Nun erinnert eine Skulptur im Loki-Schmidt Garten, dem Botanischen Garten der Universität, an den Mäzen. Obwohl 1893 zum Protestantismus konvertiert, verfolgten Emden die Repressionen des NS-Staates bis in die Schweiz, wo er bereits seit 1927 lebte und 1934 die Staatsbürgerschaft erworben hatte. Von den Nationalsozialisten wurde er gezwungen, große Teile seines Besitzes weit unter Wert zu verkaufen, bevor 1938 sein gesamtes Vermögen in Deutschland beschlagnahmt wurde. Teil des 1935 zwangsverkauften Besitzes war unter anderem ein großes Gelände, auf dem sich in Klein Flottbek heute auch der Botanischen Garten befindet. Nachdem bereits ein Weg neben dem Garten nach dem Naturliebhaber Emden benannt wurde, ehrt ihn im Park nun eine auf einer Bank sitzende Skulptur (Foto: UHH/Hense). Es handelt sich um eine Dauerleihgabe des Hamburger Kaufmanns Jürgen Jencquel. Das Freigelände des Botanischen Gartens ist im Winter täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Neue Studie zur Familienfreundlichkeit der Hamburger Hochschulen
1. Februar. Familienfreundlichkeit ist für Frauen und Eltern maßgeblich bei der Einschätzung der Attraktivität einer Hochschule, des Wissenschaftsstandorts und in Hinblick auf den eigenen Karriereverlauf. Das ist das Ergebnis der Studie „Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familienaufgaben an Hamburger Hochschulen“, die das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) im Auftrag der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB) durchgeführt hat.
Die Studie zeigt, dass es an Hamburger Hochschulen eine breite Vielfalt an Angeboten und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie gibt. Zwei Angebote haben sich als besonders wirksam gezeigt: flexible Arbeitszeiten und die Option des flexiblen Arbeitsortes. An anderen Stellen weisen niedrige Nutzungsquoten aber auf Verbesserungsbedarfe hin, wie beispielsweise eine (noch) bessere oder zielgenauere Information.
Die Untersuchung fand im Zeitraum von September 2020 bis September 2021 statt. Es wurden die sechs staatlichen Hochschulen (UHH, TUHH, HAW, HCU, HFBK, HfMT) und das UKE einbezogen.
+++
Kurzmeldungen März 2022
+++ Auf einen Kaffee mit dem Unipräsidenten +++ Bessere Radwege am Campus Bundesstraße +++ Livestream am 11. März: Russlands Krieg gegen die Ukraine – Analysen und Hintergründe +++ Geschichtsdarstellungen auf Instagram: Teilnehmende für Workshop gesucht! +++ Supercomputer „Levante“: Neuer Hochleistungsrechner für Klimaforschung in Betrieb +++ Hamburg Research Academy veröffentlicht Programm für das Sommersemester 2022 +++
Auf einen Kaffee mit dem Unipräsidenten
29. März. „Mir ist es wichtig, mit möglichst vielen von Ihnen ins Gespräch zu kommen“, sagte Prof. Dr. Hauke Heekeren in seinem Begrüßungsvideo, das er am Tag seines Amtsantritts an Mitarbeitende und Studierende verschickt hat. Am Freitag, den 8. April bietet sich nun allen Hochschulmitgliedern eine besonders gute Gelegenheit zum Austausch: Von 9.30 Uhr bis 11 Uhr steht der neue Universitätspräsident auf dem Campus Von-Melle-Park (zwischen Ententeich und Audimax) unter freiem Himmel bei einer Tasse Kaffee bereit für Fragen und Anregungen – spontan und ohne festen Termin.
+++
Bessere Radwege am Campus Bundesstraße
29. März. Die als Verkehrsversuch eingerichtete Pop Up Bikelane am Schlump zwischen Gustav-Falke-Straße und Bogenstraße soll verstetigt werden. In diesem Zusammenhang werden auch der Campus Bundesstraße sowie weitere nahegelegene Bildungseinrichtungen für einen verbesserten Radverkehr erschlossen. Das teilte die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) mit. Die laufende Analyse während des Verkehrsversuchs mit der Pop Up Bikelane und die Auswertung einer Onlinebeteiligung ergaben, dass der temporär eingerichtete Fahrradweg deutlich mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden bietet. Wegen Sielbauarbeiten wird zwischen April und Herbst 2022 die Pop Up Bikelane kurzfristig aufgehoben, bevor sie dann im Herbst fester Bestandteil des Straßenraums wird.
+++
Livestream am 11. März: Russlands Krieg gegen die Ukraine – Analysen und Hintergründe
10. März. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Welt erschüttert. Auf einer kurzfristig organisierten Podiumsdiskussion wollen deshalb Hamburger Historikerinnen und Historiker das aktuelle Geschehen einordnen und die historischen Hintergründe analysieren. Die Veranstaltung findet am 11. März 2022 von 16 bis 18 Uhr per Livestream statt.
Es diskutieren Prof. Dr. Monica Rüthers (Arbeitsbereich Osteuropäische Geschichte an der Universität Hamburg), Prof. Dr. Jörn Happel (Geschichte Osteuropas und Ostmitteleuropas an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg), Prof. Dr. Burkhard Meißner (Alte Geschichte an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg), Prof. em. Dr. Frank Golczewski (Arbeitsbereich Osteuropäische Geschichte an der Universität Hamburg) und Dr. Dmytro Myeshkov (Nordost-Institut IKGN e.V. an der Universität Hamburg). Die Moderation übernehmen Prof. Dr. Birthe Kundrus (Arbeitsbereich Deutsche Geschichte und Sprecherin der Forschungsgruppe „Gewalt-Zeiten“ an der Universität Hamburg) und Prof. Dr. Joachim Tauber (Direktor des Nordost-Instituts IKGN e.V. an der Universität Hamburg).
Die Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit der Forschungsgruppe Gewalt-Zeiten an der Fakultät für Geisteswissenschaften sowie dem Nordost-Institut IKGN e.V. an der Universität Hamburg, der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr und der Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg.
Geschichtsdarstellungen auf Instagram: Teilnehmende für Workshop gesucht!
4. März. Soziale Medien werden verstärkt als Orte der Erinnerungen genutzt – sowohl von Gedenkstätten, Museen und Medienunternehmen als auch von Initiativen, Vereinen und Privatpersonen. Umso wichtiger ist das Bewusstsein für diese Entwicklungen und die entsprechende Medienkompetenz. Das Citizen-Science-Forschungsprojekt „SocialMediaHistory“ veranstaltet zu diesem Thema in Zusammenarbeit nun den Workshop „Geschichtsdarstellungen auf Instagram“. Die Teilnehmenden lernen zunächst das Medium Instagram und seine Ausdruckformen kennen und erarbeiten anschließend mit dem Projektteam eine Analysemethode zum Umgang mit Geschichte auf Instagram. Gemeinsam werden dann Beispielbeiträge entwickelt. Für den Workshop werden 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 16 Jahren gesucht. Erste Erfahrungen im Umgang mit Instagram sind erwünscht; historisches oder geschichtswissenschaftliches Vorwissen ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. „SocialMediaHistory“ ist eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Kooperation der Universitäten Hamburg und Bochum sowie dem Verein Kulturpixel e.V. Interessierte finden weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung bis zum 18. März 2022 auf der Projektwebsite.
+++
Supercomputer „Levante“: Neuer Hochleistungsrechner für Klimaforschung in Betrieb
3. März. Zum 3. März 2022 hat das Hochleistungssystem „Levante“ des Deutschen Klimarechenzentrums (DKRZ) seinen Betrieb aufgenommen. Der neue Supercomputer vervierfacht mit 14 PetaFLOPS die Rechenleistung des DKRZ und erweitert damit die Möglichkeiten für die Simulation in hoch aufgelösten globalen Klima- und Erdsystemmodellen. Im Vergleich zu Vorgängermodellen ist es nun möglich, noch langfristigere Projektionen und Untersuchungen möglicher Klimaänderungen für verschiedene Szenarien durchzuführen. Der Supercomputer ist integraler Bestandteil der Klimaforschung am Standort Hamburg, an der die Universität Hamburg, insbesondere durch das Exzellenzcluster „Climate, Climatic Change, and Society” (CliCCS), mit zahlreichen weiteren Partnern federführend beteiligt ist. Für die Finanzierung des neuen Supercomputers bringen die Freie und Hansestadt Hamburg, die Max-Planck-Gesellschaft und die Helmholtz-Gemeinschaft insgesamt 45 Millionen Euro auf.
+++
Hamburg Research Academy veröffentlicht Programm für das Sommersemester 2022
2. März. Wie baue ich mein eigenes Netzwerk auf? Und wie kann ich langfristig von einem tragfähigen Netzwerk profitieren? Das neue Themenjahr der Hamburg Research Academy (HRA) beleuchtet das Netzwerken aus unterschiedlichsten Perspektiven. Die HRA und die Hamburger Partnerhochschulen bieten Workshops an, schaffen Gesprächsanlässe und initiieren Diskussionen. Die Anmeldephase startet ab sofort.
Neben dem „Promovierendentag“ und der Veranstaltung „Fokus Wissenschaftskommunikation“ gleich zu Beginn des Semesters, bietet die HRA auch zwei neue Veranstaltungsreihen an. In „HRA im Park“ können Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in der Kulisse von Planten und Blomen Erfahrungen mit Personen aus der Hamburger Hochschullandschaft austauschen. Bei den „HRA Stadtrundgängen“ entdecken Interessierte den Wissenschaftsstandort Hamburg mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und knüpfen wichtige Kontakte. Im kommenden Sommersemester wird das Programm der HRA in Präsenz, aber auch im digitalen Raum angeboten. Interessierte können sich auf der Webseite der HRA anmelden. Die Plätze werden nach dem Prinzip „first come, first serve“ vergeben.
+++
Kurzmeldungen April 2022
Großer Erfolg für Moot-Court-Team der Uni Hamburg +++ Begleitforschung zu On-Demand-Mobilität ist gestartet +++ „In Zeiten des Krieges vom Frieden reden“ – Podiumsdiskussion am 2. Mai 2022 +++ Mit dem Coffeebike auf dem Campus Bahrenfeld +++ DFG-Projekt „Natur und Gesellschaft erfahren“ ist gestartet +++ Neue DFG-Forschungsgruppe zur Bodenökologie +++ Neue Folge des Podcasts „Gleichheitszeichen“ +++ Roboter-Fußball: Bit-Bots der Uni Hamburg kämpfen um den Finaleinzug +++ Projekt des Unimuseums: Schulklasse kuratiert eigene Ausstellung +++ Universitätspräsident gratuliert zur Eröffnung des neuen „Centre for X-ray and Nano Science“ +++ Start der Ringvorlesung „Liberal Arts and Sciences“ +++ „Ich habe mich über die guten Gespräche gefreut“ +++ Impulse aus der Erziehungswissenschaft: Neue Ringvorlesung „Frieden bilden“ +++ Mitsteigern und gewinnen: Auktion „Kunst mit Nix“ +++ Fünf Jahre Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement +++ Das Universitätsmuseum öffnet wieder! +++
Großer Erfolg für Moot-Court-Team der Uni Hamburg
29. April. Gleich in mehreren internationalen Entscheiden konnten sich die UHH-Teilnehmenden des Willem C. Vis Moot Court in diesem Jahr erfolgreich durchsetzen. Moot Courts sind internationale Wettbewerbe, bei denen Studierende aus aller Welt in einem simulierten Schiedsgerichtsverfahren gegeneinander antreten. Die Studierenden aus Hamburg gewannen drei Pre-Moot-Veranstaltungen, unter anderem in Paris, und sicherten sich Anfang April in den Finalrunden in Wien den 2. Platz von insgesamt 365 Teams. Darüber hinaus errangen einzelne Teammitglieder sowie der Beklagtenschriftsatz und der Klägerschriftsatz Auszeichnungen. Insgesamt erreichte die Universität Hamburg die höchste Platzierung in den Endrunden bisher und zum ersten Mal eine Platzierung für einen Schriftsatz. Alle Informationen zu der Erfolgsgeschichte gibt es im ausführlichen Bericht auf der Seite der Fakultät für Rechtswissenschaft.
+++
Begleitforschung zu On-Demand-Mobilität ist gestartet
25. April. Vor zehn Monaten startete im Kreis Rendsburg ein neues Mobilitätsangebot, das Bahn und Bus ergänzt. „Remo“ ist ein sofort buchbares, voll-flexibles Nahverkehrsangebot ohne Linien- und Fahrplanbindung mit bestehenden und virtuellen Haltstellen. Die Fahrzeuge von „remo“ fahren freitags, sonnabends und sonntags abends und nachts. Die Buchung erfolgt per App oder per Telefon, in den Fahrzeugen gilt der Schleswig-Holstein-Tarif. Das Pilotprojekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt.

Um die Erfahrungen mit dem gemeinsamen Projekt von Land, Kreis und NAH.SH landesweit nutzen zu können, führt ein Forschungsteam um Prof. Dr. Katharina Manderscheid von der Universität Hamburg nun eine begleitende Forschung durch.
Ziel und Gegenstand der mobilitätssoziologischen Begleitforschung ist die Einschätzung der Nutzungspotenziale des Angebots. Insbesondere soll ermittelt werden, für welche sozialen Gruppen und im Kontext von welchen Aktivitäten das Angebot eine attraktive Verkehrsoption darstellt. Damit verbunden ist die Frage, ob das Angebot die Lebensqualität in ländlichen Räumen verbessern kann und zur Stabilisierung regionaler und lokaler Gewerbestrukturen beiträgt. Zudem soll eine erste Einschätzung vorgenommen werden, ob der Ausbau solcher digital gesteuerten Nahverkehrsangebote einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit und einer Verkehrswende in ländlichen Räumen leistet dadurch, dass Autofahrten (und mittelfristig private (Zweit-) Autos) ersetzt werden können.
+++
„In Zeiten des Krieges vom Frieden reden“ – Podiumsdiskussion am 2. Mai 2022
25. April. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für die evangelische Friedensethik? Ist eine pazifistische Haltung noch vertretbar? Und wie beeinflusst der Krieg die nationale und internationale Sicherheitspolitik? Um Fragen wie diese geht es bei der Podiumsdiskussion „In Zeiten des Krieges vom Frieden reden“ am 2. Mai um 19.30 Uhr in der Hamburger Haupt- und Universitätskirche St. Katharinen.
Zu Gast bei Hauptpastorin und Pröpstin Dr. Ulrike Murmann sind die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ursula Schröder und der Friedenstheologe Prof. Dr. Fernando Enns von der Universität Hamburg sowie die Bischöfin der Nordkirche Kirsten Fehrs und der Oberst im Generalstabsdienst Michael Strunk. Moderiert wird die Diskussion von NDR-Kulturredakteur Jan Ehlert.
Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die Veranstaltung findet ohne die G-Regeln statt, es besteht jedoch die Pflicht zum Tragen einer FFP2- Maske.
+++
Mit dem Coffeebike auf dem Campus Bahrenfeld
22. April. Zweite Station mit dem Coffeebike: Vor dem Gebäude des Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) sind heute auf dem Campus Bahrenfeld Forschende, Lehrende und Studierende „auf einen Kaffee mit dem Präsidenten“ zusammengekommen (Foto: UHH/Neuheuser). Univ.-Prof. Dr. Hauke Heekeren sagt: „Herzlichen Dank an alle, die heute dabei waren. Dass sich dabei auch untereinander Vernetzungen ergeben haben, freut mich besonders.“ Der nächste Stopp ist für den Universitätsstandort Überseering 35 geplant.
+++
DFG-Projekt „Natur und Gesellschaft erfahren“ ist gestartet
22. April. Das Forschungsprojekt „Natur und Gesellschaft erfahren. Eine multi-sited-Untersuchung meeresbiologischer und ethnografischer Feldwissenschaften“ ist Anfang April am Center for Sustainable Society Research (CSS) gestartet. Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierte Vorhaben ist mit mehr als 500.000 Euro dotiert und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Geleitet wird es von Dr. habil, Tanja Bogusz, Mitarbeiterinnen sind Nane Pelke und Kirsa Gunkel.
Im Fokus der Studie liegt die Frage, inwiefern der Feldbegriff und die Feldforschung, die einst von den Naturwissenschaften in die Sozialforschung übertragen wurden, als verbindendes Analysewerkzeug zwischen den Natur- und Sozialwissenschaften empirisch und theoretisch produktiv gemacht werden können. Dazu werden das Verständnis und die Praxis der Feldforschung an verschiedenen sozialwissenschaftlichen und meeresbiologischen Forschungseinrichtungen in Frankreich, Norwegen, Deutschland und auf Expeditionen in Übersee untersucht und ko-laborative Forschungskonzepte gemeinsam mit den Forschenden aus den Naturwissenschaften entwickelt. Mittels einer systematischen Kombination aus empirischen Studienphasen und sozial- und gesellschaftstheoretischen Explorationen strebt das Projekt an, sowohl einen begrifflich-konzeptuellen Beitrag für die Sozialwissenschaften, als auch einen konkreten Vorschlag zur Überwindung der Natur/Kultur-Dichotomie angesichts von Klimawandel und Artensterben in der Wissensgesellschaft zu liefern.
Projektpartnerinnen und Projektpartner sind u.a. das Pariser Naturkundemuseum (MNHN), die meeresbiologische Station Concarneau / Bretagne (ebenfalls MNHN), die EHESS Paris, das Konsortium Deutsche Meeresforschung (KDM) und das Leibniz Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (ehemals CENAK) an der Universität Hamburg. Weitere Informationen sind auf der Projektseite beim CSS verfügbar.
+++
Neue DFG-Forschungsgruppe zur Bodenökologie
20. April. Die Humusauflage ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt des Ökosystems Wald, an dem organisches Material, Nährstoffe, Wasser und Gase gespeichert, absorbiert und umgewandelt werden. Viele Prozesse, die ausschlaggebend für die Eigenschaften des gesamten Bodens oder sogar des Ökosystems sind, laufen in der Humusauflage ab. Gleichzeitig reagiert sie besonders empfindlich auf klimatische Veränderungen. Eine neue DFG-Forschungsgruppe unter Beteiligung der Universität Hamburg wird die Funktionsweise, Dynamik und Vulnerabilität der Humusauflage von Wäldern bei steigender Temperatur genauer erforschen. Die DFG unterstützt die Gruppe ab Juli 2022 für zunächst vier Jahre mit insgesamt 4,8 Millionen Euro.
Weitere Informationen gibt es auf den Seiten der MIN-Fakultät.
+++
Neue Folge des Podcasts „Gleichheitszeichen“
14. April. In der gerade veröffentlichten siebten Folge des Podcast „Gleichheitszeichen“ der Stabsstelle Gleichstellung geht es um institutionellen und strukturellen Rassismus an Hochschulen und die Bedeutung der antirassistischen Arbeit als zentrales Handlungsfeld im Diversitätskontext. Dr. Johanna Seibert, Gleichstellungsreferentin an der geisteswissenschaftlichen Fakultät, und Dr. Lima Sayed, Mitarbeiterin im Career Center, stellen das Projekt „Collective Responsibility“ vor, welches die Mitglieder der Universität Hamburg zur rassismuskritischen Reflexion anregen möchte und konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung rassistischer Diskriminierung erarbeitet.
Der Podcast ist auf den Seiten der Stabsstelle verfügbar.
+++
Roboter-Fußball: Bit-Bots der Uni Hamburg kämpfen um den Finaleinzug
13. April. Am kommenden Wochenende rollt der Fußball nicht nur in den großen Bundesliga-Stadien, sondern auch in der Handelskammer Hamburg. Dort findet von Donnerstag (14.04.) bis Sonntag (17.04.) zum zweiten Mal das von Hamburger Studierenden initiierte „German Open Replacement Event“ (GORE-Event) statt, bei dem deutsche und internationale Teams im Roboter-Fußball gegeneinander antreten. Mit den Hamburg Bit-Bots (Foto: Sebastian Engels) wird auch das Team der Universität Hamburg vor Ort sein. Im Rahmen der Veranstaltung werden vor Ort die Spiele der „Standard Platform League“ ausgetragen. Zudem werden Livestreams der Partien der „Humanoid League Virtual Season“ übertragen, in der die Bit-Bots am Sonntag im Halbfinale um den Einzug ins Endspiel kämpfen, das noch am gleichen Tag ausgetragen wird. Ein Besuch der Veranstaltung ist von Freitag bis Sonntag unter 3G-Bedingungen möglich. Wer kommen möchte, registriert sich über das Ticket-System. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Turnier gibt es auf der Webseite des Events.
+++
Projekt des Unimuseums: Schulklasse kuratiert eigene Ausstellung
13. April. Was soll in Museen aufbewahrt werden? Welche Themen sind uns wichtig? Und wie sollen sie dargestellt werden? Mit diesen Fragen hat sich in den vergangenen Wochen der Kunstkurs der Klassen 8b und 8b am Kurt-Körber-Gymnasiums in Hamburg-Billstedt beschäftigt. Sie haben im Rahmen des Projektes „Klasse! Kuratiert!“ die Ausstellung „The Emotionals – Menschen und Emotionen“ entwickelt. Initiiert wurde das Projekt – das von der „Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.“ mit 10.000 Euro gefördert und durch das Programm „Kulturagenten für kreative Schulen Hamburg“ unterstützt wird – von Dr. Antje Nagel, Leiterin des Universitätsmuseums und der Zentralstelle für wissenschaftliche Sammlungen der Universität Hamburg. Unter Leitung von Lara Hemken, einer freischaffenden Künstlerin, erlebten die Schülerinnen und Schüler den kreativen Prozess sowie die Diskussionen und Überlegungen hinter der Gestaltung einer Ausstellung und präsentieren nun ihre eigenen Ergebnisse. Nach der feierlichen Eröffnung am 8. April (Foto: UHH/Feuerböther) können diese noch bis zum 14. April jeden Tag von 11.30 bis 12.15 Uhr oder nach Absprache(Anna.stuecher"AT"KKg.hamburg.de) besichtigt werden (Kurt-Körber-Gymnasium, Pergamentweg 1, 22117 Hamburg, NWT-Raum).
+++
+++
Universitätspräsident gratuliert zur Eröffnung des neuen „Centre for X-ray and Nano Science“
12. April. Das „Centre for X-ray and Nano Science“, kurz CXNS, auf dem Campus Bahrenfeld ist eine interdisziplinäre, von zahlreichen Institutionen gemeinsam betriebene Plattform für die Forschung mit Röntgenlicht in Kombination mit Nano- und Materialwissenschaften. Am 12. April wurde es unter anderem im Beisein von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien eröffnet. Auch der Präsident der Universität Hamburg, Univ.-Prof. Dr. Hauke Heekeren, überbrachte persönlich die besten Wünsche: „Ich gratuliere allen am CXNS beteiligten Institutionen zum neuen Gebäude und wünsche diesem bundesländerübergreifenden Projekt großartige Erkenntnisse im Bereich der Photon Science. Die besten infrastrukturellen Voraussetzungen dafür sind geschaffen, gerade auch durch die Ansiedlung in der Science City Hamburg Bahrenfeld. Gleichzeitig wächst diese durch neue, herausragende wissenschaftliche Projekte und gewinnt damit an internationaler Strahlkraft, wie wir es uns als ebenfalls dort gut vertretende Universität Hamburg für die Hansestadt nur wünschen können.“
Start der Ringvorlesung „Liberal Arts and Sciences“
11. April. Eine interdisziplinäre wissenschaftliche Herangehensweise an die Herausforderungen unserer Gegenwart, das ist das Prinzip der Liberal Arts and Sciences. Wie das konkret aussehen kann, zeigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Forschungsdisziplinen im Sommersemester 2022 in der Ringvorlesung „Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen“. Den Auftakt machen am 14. April der experimentelle Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Stephan Porombka (Universität der Künste, Berlin) und der Buddhismusforscher Prof. Dr. Michael Zimmermann (Asien-Afrika-Institut und Exzellenzcluster „Understanding Written Artefacts“ der Universität Hamburg). In ihrem Vortrag „Meditation – Zwischen Wahrheitsfindung und ästhetischer Performance“ werden sie sich über Meditation und Achtsamkeit austauschen. Die Ringvorlesung findet jeweils donnerstags von 18 bis 20 Uhr im Hörsaal M des Hauptgebäudes, Edmund-Siemers-Allee 1, statt.
+++
„Ich habe mich über die guten Gespräche gefreut“
8. April. Und das Wetter spielte auch mit: Bei kaltem Wind, aber etwas Sonne und einer Tasse Kaffee begrüßte Univ.-Prof. Dr. Hauke Heekeren (Foto: UHH/Feuerböther) am 8. April Studierende und Beschäftigte der Universität Hamburg auf dem Campus Von-Melle-Park. Knapp zwei Stunden lang bot sich hier die Gelegenheit, den neuen Universitätspräsidenten persönlich kennenzulernen und sich auszutauschen. Viele Hochschulmitglieder nutzten das Angebot für Fragen, Vorschläge oder einfach zum Hallo sagen. Hauke Heekeren: „Vielen Dank an alle, die heute auf einen Kaffee vorbeigekommen sind! Ich habe mich über die vielen guten Gespräche mit Ihnen sehr gefreut und nehme jede Anregung, jede Frage mit. Mit Ihnen in den persönlichen Austausch treten zu können fühlt sich endlich einmal wieder wie richtiges Universitätsleben an. Und deshalb sage ich jetzt schon ‚Herzlich Willkommen' zu unserem nächsten Stopp des Coffeebikes am 22. April von 9.30 bis 11 Uhr in Bahrenfeld.“
+++
Impulse aus der Erziehungswissenschaft: Neue Ringvorlesung „Frieden bilden“
8. April. Um Frieden zu bilden, ist auch die Zivilgesellschaft gefragt. Die Wissenschaft hat Verantwortung dafür, die momentane kriegerische Zuspitzung zu analysieren und eine Perspektive für Frieden zu schaffen. Die Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg organisiert daher unter Beteiligung zahlreicher Fakultätsmitglieder im Sommersemester eine Ringvorlesung, in der verschiedene erziehungs- und bildungswissenschaftliche Zugänge, Perspektiven und konkrete Ansätze thematisiert werden. Los geht es am 26.April mit dem Vortrag „Pädagogik im Krieg – Lässt sich aus Bildungsgeschichte lernen?“ von Prof. Dr. Ingrid Lohmann. Weitere Themen sind unter anderem „Frieden für Anfänger". Comics und Friedensbildung in den 1970er- und 1980er-Jahren“ (17.05., Prof. Dr. Sylvia Kesper-Biermann) und „Gewalt und Aggressionen im Sport – sportpädagogische Umgehensweisen“ (28.06., Prof. Dr. Claus Krieger und Mikesch Bouchehri). Die Veranstaltungen (immer dienstags, 18 Uhr, Anna-Siemsen-Hörsaal im VMP 8) sind offen für alle Interessierten. Das Programm ist online abrufbar.
+++
Mitsteigern und gewinnen: Auktion „Kunst mit Nix“
7. April. Unter dem Titel „Kunst mit Nix“ präsentieren die Universität Hamburg und die Stern-Wywiol Galerie innovative und spannende Werke von Studierenden. Das Besondere: Die Bilder, Fotografien und Installationen bestehen aus Alltagsgegenständen und Müll bzw. zeigen entsprechende Motive (Foto: Louisa Sohmen). Mit diesem besonderen Fokus reflektieren die Studierenden ihre Sicht auf die Welt und unsere Gesellschaft. Die Kunstwerke können vom 19. bis 23. April 2022 in der Galerie angeschaut werden. Im Rahmen einer sogenannten „stillen Auktion“ können bei Interesse im gesamten Zeitraum Gebote abgegeben werden. Alternativ werden die Stücke auch online präsentiert, wo die Auktionsteilnahme über ein Formular möglich sein wird. Der Erlös kommt ohne Abzüge den Deutschlandstipendien an der Uni Hamburg zugute, mit denen begabte und gesellschaftlich engagierte Studierende mit erschwerten Studienbedingungen gefördert werden. Alle Informationen gibt es auf der Seite des Deutschlandstipendiums. Dort wird ab dem 19. April auch die Online-Auktion zu finden sein.
+++
Fünf Jahre Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement
4. April. Das Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement (ZFDM) feiert fünfjähriges Bestehen. Weil immer mehr Forschungsdaten in digitaler Form langfristig gesichert, systematisch archiviert und nach Möglichkeit öffentlich zugänglich gemacht werden müssen, hatte die Universität Hamburg das ZFDM am 1. April 2017 gegründet. Unter der Leitung von Dr. Stefan Thiemann bietet es seitdem ein umfassendes Serviceangebot, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Sicherung von Forschungsdaten zu beraten und aktiv zu unterstützen. So sind z. B. im Forschungsinformationssystem mittlerweile rund 55.000 Publikationen gelistet. Mit Workshops wird das Zentrum darüber hinaus ab Juni gezielt FDM-Wissen vermitteln. Neben dem Projekt „Early Education for Data Management Decisions“ sind bereits drei Workshops für Bachelorstudierende der Erziehungswissenschaft und zwei für Doktorandinnen und Doktoranden der WiSo-Fakultät geplant.
+++
Das Universitätsmuseum öffnet wieder!
4. April. Die Pandemie-bedingte Pause ist endlich vorbei: Ab Dienstag, den 5. April 2022, ist das Universitätsmuseum wieder geöffnet. Wer sich auf eine spannende Zeitreise durch die Universitätsgeschichte begeben möchte, kann das Museum an folgenden Tagen besuchen: dienstags von 10 bis 14 Uhr, donnerstags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für Gruppen gibt es auch die Möglichkeit, sich zu einer Führung anzumelden(unimuseum"AT"uni-hamburg.de).
+++
+++
Kurzmeldungen Mai 2022
+++ Hamburger Studierendentagung zur Innovativen Medizin und Biotechnologie an der Uni Hamburg +++ HUL veröffentlicht Bericht zur Transformation der Lehre während der Corona-Pandemie +++ Studie: Mit „News-Shocks“ gegen Doping +++ „Bau deine Stabi“ – Ausstellung mit Entwürfen für die Stabi der Zukunft +++ Eröffnungssymposium des “Center for Data and Computing in Natural Science” (CDCS) +++ Prof. Dr. Dagmar Felix in Krankenhaus-Kommission berufen +++ Wissenschaftler und Künstler – Biografie des Mathematikers Emil Artin erschienen +++
Hamburger Studierendentagung zur Innovativen Medizin und Biotechnologie an der Uni Hamburg
25. Mai. Bereits zum 17. Mal haben Studierende im Rahmen der Studierendentagung ihre wissenschaftlichen Projekte mit Schwerpunkten in Medizintechnik, Biotechnologie oder Pharmazie vorgestellt. Dabei wurden die besten Präsentationen von der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke, die die Schirmherrschaft innehat, ausgezeichnet. Fünf Hamburger Hochschulen organisieren die Tagung, bei der die Universität Hamburg in diesem Jahr Gastgeberin war.
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten der MIN-Fakultät
+++
HUL veröffentlicht Bericht zur Transformation der Lehre während der Corona-Pandemie
11. Mai. Wie verändert sich das Lehren und Studieren unter digitalen Bedingungen? Das untersuchen zwei Teams des Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen (HUL). Bereits seit dem Wintersemester 2020/21 laufen die Trendstudien zur „Transformation von Lehren und Studieren unter digitalen Bedingungen“ (TaLeS) aus Lehrenden- und Studierendenperspektive.
Das Forschungsteam um Prof. Dr. Gabi Reinmann hat die Lehrendenstudie nach drei Semestern nun mit einem Vergleichsbericht abgeschlossen. Ziel war es, die didaktische Entwicklung der Lehre im Anschluss an die Notfallverlegung der Lehre in den digitalen Raum aus der Perspektive der Lehrenden zu erfassen. Dabei sollten Veränderungen in der Verknüpfung von Forschung und Lehre festgestellt und die Informationsbasis für die didaktische Unterstützung und Qualifizierung von Lehrenden verbessert werden. Die Studie zur Studierendenperspektive läuft weiter.
+++
Studie: Mit „News-Shocks“ gegen Doping
4. Mai. Über die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa wurde bei den olympischen Winterspielen in Peking 2022 viel gesprochen. Sie überzeugte zunächst mit einer beeindruckenden sportlichen Leistung - kurz danach war vor allem ihr positiver Dopingtest Thema und es wurde diskutiert, wie Doping verhindert werden kann.
Eine neue Möglichkeit könnten „News Shocks“ sein, also schlichte Ankündigungen von Anti-Doping-Maßnahmen, unabhängig vom Zeitpunkt der geplanten Umsetzung. Einer Studie von Prof. Dr. Wolfgang Maennig und Viktoria C. E. Schumann vom Fachbereich Volkswirtschaftslehre der Universität Hamburg zufolge können solche „News Shocks“ im Kampf gegen Doping helfen, da durch sie Doping-Aktivitäten von Sportlerinnen und Sportlern abnehmen. Diese Erkenntnis kann für medizinische und/oder pharmakologische Testverfahren nützlich sein. Und zwar dann, wenn diese theoretisch möglich, in der Praxis aber zu kostspielig sind. Darüber hinaus könnten die Erkenntnisse auch abseits des Sports hilfreich sein, etwa indem die Möglichkeit von „News Shocks“ beispielsweise auf die Kriminalitätsbekämpfung übertragen werden.
„Bau deine Stabi“ – Ausstellung mit Entwürfen für die Stabi der Zukunft
4. Mai. Im Rahmen des Entwicklungsprojekts „Wissen Bauen 2025“ der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (Stabi) haben Studierende von drei renommierten Architekturfakultäten Entwürfe erarbeitet, wie eine Stabi der Zukunft aussehen kann. Die 15 besten Poster und Modelle werden vom 5. Mai bis zum 5. Juli 2022 im Lichthof der Stabi ausgestellt. Besucherinnen und Besucher können für ihren Lieblingsentwurf abstimmen. Der Favorit wird am Abend des 5. Juli mit einem Publikumspreis ausgezeichnet.
Beteiligt waren Studierende der HafenCity Universität Hamburg (Prof. Gesine Weinmiller), der Bauhaus-Universität Weimar (Prof. Jörg Springer) und der Technischen Universität Dresden (Prof. Ivan Reimann).
Die Ausstellung beginnt am 5. Mai 2022 um 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eingang zur Eröffnung: Grindelallee/Ecke Edmund-Siemers-Allee. Um Anmeldung(pr"AT"sub.uni-hamburg.de) wird gebeten.
+++
Eröffnungssymposium des “Center for Data and Computing in Natural Science” (CDCS)
3. Mai. Die Naturwissenschaften haben in den vergangenen Jahrzehnten mithilfe des Einsatzes von Computern große Fortschritte gemacht. Für die Entwicklung neuer informatischer Konzepte zur Prozessierung und Analyse der gigantischen Datenmengen aus der Forschung wurde 2020 in Hamburg das „Center for Data and Computing in Natural Science“ (CDCS) als Hamburg-X Projekt etabliert. In interdisziplinären Teams forschen Physiker, Chemiker und Biologen mit Informatikern an innovativen Verfahren unter Einsatz von Data Science und Maschinellem Lernen. Vom 26. bis 28. April 2022 fand nun auf dem Campus der Science City Hamburg Bahrenfeld das Auftaktsymposium des CDCS statt. Weitere Informationen gibt es auf den Seiten der MIN-Fakultät.
+++
Prof. Dr. Dagmar Felix in Krankenhaus-Kommission berufen
3. Mai. Die Sozialrecht-Professorin Dr. Dagmar Felix wurde von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in die „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ berufen. Das Gremium ist mit 15 Expertinnen und Experten aus Pflege und Medizin, der Ökonomie sowie den Rechtswissenschaften besetzt und hat außerdem einen Koordinator. Es soll Empfehlungen zu einzelnen Fragen der Krankenhausversorgung erarbeiten, die Grundlage für die ab 2023 geplanten Krankenhausreformen werden sollen. Die Kommission soll sich noch im Mai 2022 konstituieren und ihre Arbeit aufnehmen.
+++
Wissenschaftler und Künstler – Biografie des Mathematikers Emil Artin erschienen
2. Mai 2022. Der Hörsaal M im Hauptgebäude der Universität trägt seit 2005 seinen Namen – Emil Artin (1898–1962) zählt zu den maßgeblichen Mathematikern des 20. Jahrhunderts. Nachdem er 1922 nach Hamburg gekommen war, trugen seine Arbeiten wesentlich dazu bei, dass die Mathematik an der noch jungen Hamburgischen Universität Weltgeltung erlangte. Eine umfangreiche Biografie von Dr. Alexander Odefey, die jetzt im Wallstein Verlag erschienen ist, zeigt Artin nicht nur als brillanten Forscher, Lehrer und Vortragenden, sondern als Menschen mit einer ausgeprägten Neigung zur Musik, der mehrere Instrumente spielte und zu seinem Freundeskreis auch Künstlerinnen und Künstler zählte. Artin wurde 1937 von den Nationalsozialisten wegen seiner „nichtarischen“ Ehefrau aufgrund der „Nürnberger Gesetze“ in den Ruhestand versetzt. Er emigrierte in die USA, wo er seine wissenschaftliche Arbeit fortsetzte. 1958 kehrte er an die Universität Hamburg zurück und wurde Direktor des Mathematischen Seminars.
+++
Kurzmeldungen Juni 2022
Jahreskonferenz DFG-Kolleg-Forschungsgruppe „Zukünfte der Nachhaltigkeit“ +++ „Abgelehnt“ – Ausstellung und Podiumsdiskussion zum Radikalenbeschluss von 1972 +++ Sammlungsportal „FUNDus“: Neue Objekte aus der Sternwarte Bergedorf +++ „Excellence in Schools“: Containerlabor präsentiert Forschung an Hamburger Gymnasium +++ Neue Kurzfilm-Reihe zeigt „Forschung für alle“ +++ Rien ne va plus: Abschlussarbeiten der „Performance Studies“ am 24. + 25. Juni im Lichthof-Theater +++ Feierliche Zeremonie: Schwedischer König übergibt Gregori-Aminoff-Preis an Prof. Dr. Henry Chapman +++ Exzellenzcluster „Understanding Written Artefacts“: Tag der offenen Tür am 10. und 11. Juni 2022 +++ Neue Studie: Deutsche hören weniger Musik als vor Corona +++
Jahreskonferenz DFG-Kolleg-Forschungsgruppe „Zukünfte der Nachhaltigkeit“
29. Juni. Was bedeutet das Konzept der planetaren Grenzen für das Konzept der Zukünfte der Nachhaltigkeit? Vor dem Hintergrund dieser zentralen Fragestellung brachte die Jahreskonferenz der DFG-Kolleg-Forschungsgruppe „Zukünfte der Nachhaltigkeit“ naturwissenschaftliche Perspektiven und sozialwissenschaftliche Sichtweisen in einen Dialog. Die Konferenz fand vom 31. Mai bis 1. Juni 2022 im Warburg-Haus statt. Interessierte finden den vollständigen Konferenzbericht sowie eine Bildergalerie auf der Webseite der Veranstaltung.
+++
„Abgelehnt“ – Ausstellung und Podiumsdiskussion zum Radikalenbeschluss von 1972
28. Juni. Vor gut 50 Jahren beschlossen Bund und Länder, sogenannte „Verfassungsfeinde“ vom öffentlichen Dienst gezielt fernzuhalten. Bis Ende der 1970er Jahre wurden daher auch in Hamburg Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst auf ihre Verfassungstreue geprüft. Diese Praxis und ihre Folgen für die betroffenen Hamburgerinnen und Hamburger hat die Forschungsstelle für Zeitgeschichte an der Universität Hamburg im Auftrag des Hamburger Senats nun wissenschaftlich aufbereitet. Ein Ergebnis ist die Ausstellung „Abgelehnt – Der Radikalenbeschluss von 1972 in Hamburg“, die vom 5. bis 7. und vom 11. bis 27. Juli 2022 in Rathausdiele zu sehen ist. Am 7. Juli 2022 ist von 17.00 bis 18.30 Uhr außerdem eine Podiumsdiskussion mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, einer Historikerin und einem Senatsvertreter vorgesehen. Die Podiumsdiskussion findet im Rahmen eines Senatsempfangs statt, die Öffentlichkeit kann sie im Livestream verfolgen.
+++
Sammlungsportal „FUNDus“: Neue Objekte aus der Sternwarte Bergedorf
28. Juni. Sie sind ein Stück Wissenschaftsgeschichte: An den historischen Teleskopen der Hamburger Sternwarte lässt sich die Entwicklung der Astronomie nachvollziehen und sie geben einen Eindruck wichtiger Meilensteine dieser Disziplin. Nun können die Großgeräte auch im Sammlungsportal „FUNDus“ der Universität Hamburg recherchiert werden. Seit 2018 haben Interessierte hier die Möglichkeit, anhand von Fotos und Detailinformationen mehr über die Millionen Objekte in den wissenschaftlichen Sammlungen der Uni zu erfahren. Der dargestellte Bestand der Hamburger Sternwarte umfasst dabei Instrumente aus der Zeit von 1867 bis 1975 – eine Periode, die den Übergang von der klassischen Astronomie zur modernen Astrophysik markiert. Mit dem originalen Schmidt-Spiegel gehört zur Sammlung auch eine Weltsensation von 1930, mit der die Ära der fotografischen Himmelsdurchmusterungen begann. Alle Informationen gibt es im „FUNDus“-Portal.
„Excellence in Schools“: Containerlabor präsentiert Forschung an Hamburger Gymnasium
22. Juni. Das neue Containerlabor des Exzellenzclusters „Understanding Written Artefacts“ (UWA) ist dafür gebaut, wertvolle Schriftartefakte überall auf der Welt präzise zu untersuchen. Vor seinem ersten Einsatz im Feld, der für das Frühjahr 2023 geplant ist, war es nun in Hamburg unterwegs: Am 14. und 15. Juni lernten Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Süderelbe in den fünf Containern die Techniken moderner Manuskriptforschung kennen. Zunächst erläuterten unter anderem Historikerinnen und Musikologen, welche Rolle Manuskripte in ihrer Forschung spielen, welche Fragen sie beschäftigen und inwiefern naturwissenschaftliche Analyseverfahren zur Beantwortung beitragen. Im Kernteil des Programms lernten die Schülerinnen und Schüler diese Verfahren dann praktisch kennen – darunter DNA-, Proteom- und Röntgenfluoreszenzanalysen. Es war die erste Auflage von „Excellence in Schools“, einem interaktiven Programm des Exzellenzclusters UWA, in dem Oberstufenschülerinnen und -schüler erleben können, wie und warum Schriftartefakte heute erforscht werden. Einen ausführlichen Bericht zum Auftakt von „Excellence in Schools“ gibt es auf den Seiten des Exzellenzclusters.
+++
Neue Kurzfilm-Reihe zeigt „Forschung für alle“
22. Juni. Ein Ausflug in Labore und manchmal auch in ungeahnte Höhen: In der neuen Kurzfilm-Reihe „Forschung für alle“ erklären Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, welche konkreten Alltagsbezüge die Exzellenzforschung an der Universität Hamburg aufweist und wie der Alltag in verschiedenen Forschungseinrichtungen aussieht.
In der ersten Folge, die auf Deutsch und auf Englisch verfügbar ist, zeigt Dr. Lennart Sobirey vom Exzellenzcluster „CUI: Advanced Imaging of Matter“, was die Herausforderung bei der Forschung zu Supraleitern ist. Im zweiten Teil (Deutsch/Englisch) erklärt Prof. Dr. Timo Weigand vom Exzellenzcluster „Quantum Universe“, was die Stringtheorie mit der Gravitationskraft und was Einstein mit der Entwicklung von GPS zu tun hat.
+++
Rien ne va plus: Abschlussarbeiten der „Performance Studies“ am 24. + 25. Juni im Lichthof-Theater
20. Juni. Welche Begegnungen erwarten uns? Welches Wissen wollen wir teilen? Welche Bühnen bleiben uns? Welche werden von uns neu erschaffen? Mit diesen Fragen setzen sich Zarah Uhlmann und Sophia Sylvester Röpcke in ihren Werken auseinander. Uhlmann und Röpcke sind die beiden letzten Absolventinnen des Masterstudiengangs „Performance Studies“ und präsentieren ihre Abschlussarbeiten am 24. und 25. Juni 2022 (jeweils 19 Uhr) im Lichthof-Theater. Sie werfen mit „Die ersten 20 Sekunden“ (Uhlmann) und „Back Stage Back“ (Röpcke) einen forschenden, kreativen, humorvollen und kritischen Blick auf die Hamburger Performance-Landschaft. Mit diesen Darbietungen endet der Studiengang „Performance Studies“, der seit 2005 an der Universität Hamburg angeboten wurde, zum Wintersemester 2022/23. Im Zentrum des Studiums standen die kritisch-politische und theoretisch-praktische Auseinandersetzung mit Aufführungen und Inszenierungen in den szenischen Künsten, in der populären Kultur, den Medien und im Alltag. Mehr Informationen zur Veranstaltung sowie Karten gibt es auf der Seite des Lichthof-Theaters.
+++
Feierliche Zeremonie: Schwedischer König übergibt Gregori-Aminoff-Preis an Prof. Dr. Henry Chapman
15. Juni. Mehrmals musste die Übergabe aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden, jetzt konnte Prof. Dr. Henry Chapman den Gregori-Aminoff-Preis für Kristallographie 2021 vom schwedischen König Carl XVI Gustaf entgegennehmen. Der Physiker ist leitender Wissenschaftler bei DESY, Professor an der Universität Hamburg und einer der Sprecher des Exzellenzclusters „CUI: Advanced Imaging of Matter“. Zusammen mit Janos Hajdu (Universität Uppsala) und John Spence (Arizona State University) wurde er im Stockholmer Rathaus ausgezeichnet.
+++
Exzellenzcluster „Understanding Written Artefacts“: Tag der offenen Tür am 10. und 11. Juni 2022
8. Juni. Am 10. und 11. Juni präsentiert das Exzellenzcluster „Understanding Written Artefacts“ seine Forschung bei einem Tag der offenen Tür. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge, Filme und ein Science Slam. Außerdem kann das neue mobile Containerlabor besichtigt werden. Das Programm ist auf den Seiten des Clusters abrufbar.
+++
Neue Studie: Deutsche hören weniger Musik als vor Corona
3. Juni. Wie hat die COVID-19 Pandemie den Musikkonsum der Deutschen beeinflusst? Eine aktuelle Studie in Kooperation der Universität Hamburg und der Kühne Logistics University hat die Auswirkungen der Pandemie auf den Musikkonsum und die Ausgaben für Musik in Deutschland untersucht. Die Ergebnisse zeigen: Nicht nur der Konsum von Live-Musik ist in der Pandemie praktisch auf null zurückgegangem, auch in den heimischen vier Wänden hörten die Deutschen 2020/21 rund drei Stunden weniger Musik als vor Beginn der Pandemie. Vor allem das Radio verlor Zuhörende, profitiert hat dagegen das sogenannte „Premium-Streaming“. Insgesamt gingen die wöchentlichen Ausgaben für Musik um fast die Hälfte zurück. Gleichzeitig zeigen sich die Konsumentinnen und Konsumenten bereit, auch für Live-Musik im Online-Format Geld auszugeben. Die Studie, an der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Professur „Marketing & Media” der Fakultät für Betriebswirtschaft der Uni Hamburg beteiligt waren, wurde im Fachmagazin PLOS One veröffentlicht.
+++
MIN-Fakultät wählt Prof. Dr. Norbert Ritter zum neuen Dekan
2. Juni. Der Fakultätsrat der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der Universität Hamburg hat den Informatiker Prof. Dr. Norbert Ritter einstimmig für die Amtszeit 1. August 2022 bis 31. Juli 2027 zum neuen Dekan der MIN-Fakultät gewählt. Er folgt damit auf Prof. Dr. Heinrich Graener, der Ende Juli 2022 in den Ruhestand treten wird.
+++
Kurzmeldungen Juli 2022
+++ Wissenschaft in drei Minuten: Three Minute Thesis-Wettbewerb 2022 der HRA +++ DFG-Kolleg „Zukünfte der Nachhaltigkeit“: Neuer Band der Buchreihe +++ Feierstunde zur Amtsübergabe des MIN-Dekans +++ Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt veröffentlicht Kunstaktion Grandweg +++ Gleichstellungspreis 2022 der UHH verliehen +++ Sprecherwechsel im Exzellenzcluster Quantum Universe +++ Auf einen Kaffee mit dem Unipräsidenten – am 12. Juli am Überseering +++ EU4Health-Förderung: 135.000 Euro für Teilprojekt der UHH +++ Theaterprojekt reflektiert Rassismus: Augsburger Wissenschaftspreis geht erneut an Hamburger Studierende +++Open-Access-Publikationen: Hamburg University Press mit erneuertem Webauftritt +++ Interessierte herzlich eingeladen: Internationale Tagung „Gabriele Tergit. Chronistin & Kritikerin der Moderne“ am 22. und 23. Juli 2022 +++
Wissenschaft in drei Minuten: Three Minute Thesis-Wettbewerb 2022 der HRA
28. Juli. Der Three Minute Thesis-Wettbewerb ist ein international renommierter Wettbewerb, der rund um die Welt an zahlreichen Universitäten stattfindet. Promovierende unterschiedlicher Fachrichtungen treten am 28. Juli 2022 ab 18.30 Uhr gegeneinander an und stellen in nur drei Minuten ihr Dissertationsprojekt vor. Die Veranstaltung im Besenbinderhof 57a ist eine gute Gelegenheit, die Forschungsvielfalt in Hamburg kennenzulernen und in andere Disziplinen einzutauchen! Der Promovierenden-Rat der Hamburg Research Academy lädt alle Interessierten herzlich zu diesem unterhaltsamen Abend ein. Um Anmeldung wird gebeten, der Eintritt ist frei. Die Beiträge werden auf Deutsch oder Englisch gehalten, die Moderation findet auf English statt.
+++
DFG-Kolleg „Zukünfte der Nachhaltigkeit“: Neuer Band der Buchreihe
25. Juli. Sind Kapitalismus und Nachhaltigkeit miteinander vereinbar? Falls ja: Welche Folgen haben die Antworten, die kapitalistische Ökonomien auf die vielen ökologischen Krisen finden? Oder scheitert der Kapitalismus letztlich an der ökologischen Frage? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigen sich die Autorinnen und Autoren des Bandes „Kapitalismus und Nachhaltigkeit“. Es ist der vierte Band in der Buchreihe „Zukünfte der Nachhaltigkeit“ des gleichnamigen Forschungskollegs, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird. Das Buch ist im Campus Verlag erschienen und wird von Prof. Dr. Sighard Neckel, Dr. Philipp Degens und Dr. Sarah Lenz herausgegeben. Mehr Informationen zur Neuerscheinung sowie zu den weiteren Publikationen der Reihe gibt es auf der Webseite des Kollegs.
+++
Feierstunde zur Amtsübergabe des MIN-Dekans
21. Juli. Am 14. Juli fand die offizielle Feierstunde zur Amtsübergabe des MIN-Dekans von Prof. Dr. Heinrich Graener an Prof. Dr.-Ing. Norbert Ritter im Hörsaal des Geomatikums der Universität Hamburg statt. In dem bunten Programm wurden nicht nur vergangene Erfolge gefeiert, sondern auch in die Zukunft geblickt.
Weitere Informationen gibt es auf den Seiten der MIN-Fakultät.
+++
Forschungsprojekt „Klimafreundliches Lokstedt“ veröffentlicht Kunstaktion Grandweg
21. Juli. Das Forschungsprojekt „Klimafreundliches Lokstedt“ hat zusammen mit THERIOT & FREIN künstlerische Visionen für öffentliche Räume als Banner am Bauzaun veröffentlicht. Dahinter standen die Fragen, wie öffentliche Räume aussehen könnten, wenn alles möglich und nichts vorgegeben wäre und was abseits der gängigen Planung möglich ist. Inspiriert durch vielfältige Anregungen aus der Öffentlichkeit und mit freundlicher Unterstützung von HAMBURG WASSER haben die Künstlerinnen Utopien für öffentliche Räume in Bilder übersetzt. Diese wurden unter anderem im Beisein der Leiterin des Teilprojektes Prof. Dr. Katharina Manderscheid, dem Projektleiter von HAMBURG WASSER Jan Gerd Meyer, der Künstlerinnen und der Arbeitsgruppe und Anwohnenden und Interessierten an den Baustellenzäunen von HAMBURG WASSER im Grandweg angebracht. Die Kunstwerke werden für die Dauer der Baustellen an den Bauzäunen angebracht bleiben und der Öffentlichkeit zugänglich sein.
Weitere Indormationen gibt es auf der Projektwebseite.
+++
Gleichstellungspreis 2022 der UHH verliehen
14. Juli. Den diesjährigen Gleichstellungspreis der Universität Hamburg für herausragendes Engagement in den Bereichen Geschlechtergerechtigkeit, Diversität und Vereinbarkeit erhielt die Initiative Bildung – Macht – Rassismus. Ziel der Initiative ist die Stärkung rassismuskritischen Denkens und Handelns im universitären Alltag und die Förderung eines konstruktiven Umgangs mit Diversität. Die Preisverleihung fand erstmals seit Pandemiebeginn wieder in Präsenz statt. Im Juni wurden mit einem Festakt die diesjährigen Preistragenden geehrt und zugleich auch die Urkunden der Gleichstellungspreise 2020 und 2021 verliehen.
+++
Sprecherwechsel im Exzellenzcluster Quantum Universe
13. Juli. Die Teilchenphysikerin Prof. Dr. Erika Garutti ist neue Sprecherin des Exzellenzclusters Quantum Universe. Sie übernimmt das Amt von Prof. Dr. Jan Louis, gemeinsam mit der bisherigen Co-Sprecherin Prof. Dr. Géraldine Servant und Prof. Dr. Timo Weigand, der auf Co-Sprecher Prof. Dr. Peter Schleper folgt. Jan Louis und Peter Schleper bringen das Forschungsprogramm des Exzellenzclusters künftig als leitende Wissenschaftler mit voran.
Mit dem Wechsel an der Spitze des Exzellenzclusters gab es auch Veränderungen im Vorstand des Clusters. Erika Garuttis bisherige Funktion als Koordinatorin der Plattformen übernimmt Prof. Dr. Gregor Kasieczka. Neuer Direktor der Quantum Universe Graduiertenschule ist Prof. Dr. Dieter Horns. Sein Nachfolger als Leiter des Forschungsbereichs „Dunkle Materie“ ist Dr. Kai-Schmidt-Hoberg. Als neue Direktorin für Öffentlichkeitsarbeit wurde Prof. Dr. Freya Blekman gewählt.
+++
Auf einen Kaffee mit dem Unipräsidenten – am 12. Juli am Überseering
11. Juli. Am Dienstag, den 12. Juli 2022, geht es weiter mit der Aktion „Auf einen Kaffee mit dem Unipräsidenten“ – dieses Mal am Überseering 35. Das Coffee-Bike steht direkt vor dem Eingang unterm Vordach. Von 11 bis 12.30 Uhr bietet sich vor Ort die Gelegenheit zum Austausch mit Prof. Dr. Hauke Heekeren.
+++
EU4Health-Förderung: 135.000 Euro für Teilprojekt an der Uni Hamburg
11. Juli. Plasma ist ein wichtiger Rohstoff für viele Medikamente und Behandlungen. Allerdings ist die Versorgung stark davon abhängig, dass ausreichend Menschen spenden. Viel Plasma für europäische Produkte muss zum Beispiel aus den USA bezogen werden. Im Rahmen des Projektes „SUPPLY“ soll der Weg von der Plasmagewinnung zur Weiterverarbeitung gezielt erforscht und gestärkt werden. Dazu kooperieren die Forschenden mit Blutbanken und nationalen Behörden aus ganz Europa. Das Projekt, das von der European Blood Alliance in Belgien geleitet wird, erhält zudem im Rahmen des EU4Health-Programms rund 1,1 Millionen Euro. 135.000 Euro gehen an die Fakultät für Betriebswirtschaft der Universität Hamburg, wo ein Team um Prof. Dr. Michel Clement vor allem untersuchen wird, wie Spenderinnen und Spender neu gewonnen und gehalten werden können. Dabei steht unter anderem im Fokus, wie sich finanzielle oder anders geartete Anreize auf Spenden auswirken und welche der in Deutschland angewendeten Strategien sich als erfolgreich herausgestellt haben. Zudem sollen die Auswirkungen der Corona-Pandemie untersucht werden. Am Ende des Gesamtprojekts sollen Empfehlungen und Leitlinien für die verschiedenen Akteurinnen und Akteure in der Plasmaspende stehen, die helfen sollen, die Plasmasammlung auszubauen und eine stabile Versorgung in der EU zu erreichen.
+++
Theaterprojekt reflektiert Rassismus: Augsburger Wissenschaftspreis geht erneut an Hamburger Studierende
8. Juli. Nach der Auszeichnung von Jennifer Adolé Akue-Dovi 2021 geht der „Augsburger Wissenschaftspreis für interkulturelle Studien“ auch in diesem Jahr wieder an zwei Studierende der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg. Krishanthi Paramalingam und Kristofer Weinstein-Storey wurden am 7. Juli 2022 für ihre Masterarbeit in der Kategorie „Förderpreis“ ausgezeichnet. Sie wählten das Medium Theater, um Perspektiven von deutschen Oberstufen-Schülerinnen und -Schülern zum Thema Rassismus zu erforschen. Dabei entwickelten Schülerinnen und Schüler of Color das Theaterstück „Wo kommst du her?“ und verarbeiteten darin ihre Erfahrungen mit Diskriminierung. Eine Gruppe von Weißen Schülerinnen und Schülern wurde nach dem Schauen des Stückes zu ihrer Rezeption befragt. In Gruppendiskussionen und Leitfadeninterviews mit beiden Gruppen wurden die Eindrücke festgehalten und anschließend analysiert. Unter anderem stellten die Forschenden fest, dass „Rassismus, insbesondere Alltagsrassismus, in Deutschland im schulischen Kontext bisher nicht genug vorkommt“, so Kristofer Weinstein-Storey. Die Abhandlung geschehe oft historisch, aber kaum mit Bezug zur heutigen Zeit. Auch um zu das ändern, wurde das Theaterstück zu einem Spielfilm adaptiert, der nun für den Unterricht in Schulen zur Verfügung steht. Ein ausführliches Interview mit Krishanthi Paramalingam und Kristofer Weinstein-Storey finden Sie auf der Webseite der Fakultät für Erziehungswissenschaft.
+++
Open-Access-Publikationen: Hamburg University Press mit erneuertem Webauftritt
6. Juli. Der Open-Access-Publikationsdienst im Angebot der Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Hamburg präsentiert sein Angebot seit Kurzem in einer technisch komplett erneuerten Umgebung. Hamburg University Press folgt dem Goldenen Weg des Open Access für Bücher wie auch für gehostete Zeitschriften. Die Veröffentlichungen stehen online zur freien Lektüre und zum kostenlosen Herunterladen sowie zur Nachnutzung zur Verfügung.
Neben einem Angebot für Dissertationen, die zeitgleich in gedruckter wie auch digitaler Form erscheinen, unterstützt Hamburg University Press insbesondere die Gründung von Reihen für die aktuelle Forschung und fördert die nachhaltige Sichtbarkeit der digitalen Veröffentlichungen.
+++
Interessierte herzlich eingeladen: Internationale Tagung „Gabriele Tergit. Chronistin & Kritikerin der Moderne“ am 22. und 23. Juli 2022
4. Juli. Gabriele Tergit lebte von 1894 bis 1982 und ist heute als herausragende Gerichtsreporterin und pointierte Schriftstellerin bekannt. Am 22. und 23. Juli widmet sich eine internationale Konferenz dem Leben und Wirken der geborenen Berlinerin. Unter anderem betrachtet Sebastian Schirrmeister vom Exzellenzcluster „Understanding Written Artefacts“ der Uni Hamburg in seinem Vortrag Gabriele Tergits Palästina-Reportagen genauer und Prof. Dr. Doerte Bischoff, UHH-Professorin für Neuere deutsche Literatur mit dem Schwerpunkt des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart, diskutiert am 22. Juli bei einer Podiumsveranstaltung mit Jens Bisky, Nicole Henneberg und Martina Wernli über die Rezeptionsgeschichte Gabriele Tergits. Die Tagung findet im Warburg-Haus statt und ist eine Kooperation der „Walter A. Berendsohn Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur“ der Uni Hamburg mit der Bergischen Universität Wuppertal und der Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung. Alle Interessierten sind zu den Veranstaltungen und Diskussionen herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen gibt es auf der Newsseite zur Tagung.
Kurzmeldungen August 2022
+++ Aktuelle Studie zu extremistischen Einstellungen in Deutschland +++ Strategie, Transfer, Internationalisierung: Neuer Beirat für die Fakultät für Betriebswirtschaft +++ 11. – 12. November: Thementagung der deutschen Politikwissenschaft zum Ukraine-Krieg +++ Öffentliche Ergebnispräsentation: Studierendenprojekt zur neuen Stabi-Ausstellung über die erste Generation der Holocaustforschung +++ Staatsrätin besucht Hamburger Zentrum für Quantentechnologien +++ Studierende der Uni Hamburg bei European University Games erfolgreich +++
Aktuelle Studie zu extremistischen Einstellungen in Deutschland
31. August. Welche Einstellungen hat die Bevölkerung in Deutschland zu aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft, zu Demokratie und Freiheitsrechten? Wie steht es um Intoleranz oder Hass gegenüber Fremden und Andersdenkenden oder um die Haltung zu Gewalt als Mittel der Interessendurchsetzung? Im Rahmen des Forschungsverbundes MOTRA (Monitoringsystem und Transferplattform Radikalisierung) führt ein Team des Kriminologen Prof. Dr. Peter Wetzels im Rahmen der Studie "Menschen in Deutschland" (MiD) jährlich deutschlandweit eine repräsentative Befragung durch. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2021 stehen jetzt zum Download bereit. Sie werden auch auf der MOTRA-Konferenz #2022 (1. bis 2. September) in Wiesbaden vorgestellt.
Ziel des Projekts MOTRA ist ein systematisches und ganzheitliches Monitoring des Radikalisierungsgeschehens in Deutschland. MOTRA soll außerdem eine zentrale Plattform für Wissenschaft, Behörden, Zivilgesellschaft und Politik sein zum Austausch über Wissen zur Früherkennung und Prävention von Extremismus.
+++
Strategie, Transfer, Internationalisierung: Neuer Beirat für die Fakultät für Betriebswirtschaft
30. August. Die Fakultät für Betriebswirtschaft der Universität Hamburg hat traditionell enge Kontakte in die Praxis und ist unter anderem in den Themenfeldern Transfer, Kooperation und Gründung sehr aktiv. Nun soll ein Beirat diesen Austausch mit externen Stakeholdern in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft weiter stärken. Die zehn Mitglieder kommen am 1. September 2022 erstmals zusammen und werden sich anschließend mindestens einmal jährlich treffen. Zudem stehen die Beiratsmitglieder – die ihre Tätigkeit ehrenamtlich ausüben – für spezielle Fachthemen in kleineren Gesprächsformaten zur Verfügung. Unter anderem wird es um Strategie, Internationalisierung und Transfer gehen. Die Gründung des Beirats geht zurück auf die Fachberatungen, die Mitte 2016 vom Präsidium der Universität Hamburg initiiert worden waren – mit dem Ziel, die vom Wissenschaftsrat vorgelegten Empfehlungen für die einzelnen Fächer und Fächergruppen zu konkretisieren. Mehr Informationen zum Beirat und den Mitgliedern gibt es auf der Webseite der Fakultät für Betriebswirtschaft.
+++
11. – 12. November: Thementagung der deutschen Politikwissenschaft zum Ukraine-Krieg
24. August. Viele Forschende der Internationalen Beziehungen (IB) wurden vom russischen Angriff auf die Ukraine überrascht. Während die deutsche Politik anlässlich der russischen Invasion der Ukraine eine ‘Zeitenwende’ erkennt, sieht sich die deutsche Politikwissenschaft noch im Verarbeitungsprozess. Die Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) stellt daher ihre diesjährige Thementagung unter das Motto: „Zeitenwende in der deutschen IB? Wie wir auf die russische Invasion der Ukraine reagieren (sollten)“. Die Tagung, die vom 11. bis 12. November 2022 an der Universität Hamburg stattfindet, wurde von Prof. Antje Wiener PhD vom Lehrstuhl für Global Governance gemeinsam mit Forschenden verschiedener Universitäten organisiert. Neben der wissenschaftlichen Diskussion ist auch eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit geplant. Wissenschaftliche Themenvorschläge können noch bis zum 31. August eingereicht werden.
+++
Öffentliche Ergebnispräsentation: Studierendenprojekt zur neuen Stabi-Ausstellung über die erste Generation der Holocaustforschung
23. August. Die Ausstellung „Verfolgen und Aufklären. Die erste Generation der Holocaustforschung“ in der Staats- und Universitätsbibliothek (Stabi) gibt ab dem 24. August Einblick in Leben und Arbeit von zwanzig Pionierinnen und Pionieren der Holocaustforschung. Sie dokumentierten noch während des Krieges die Taten und sicherten Spuren. 42 Lehramtsstudierende haben sich in zwei Seminaren zur Geschichtsdidaktik mit der Frage beschäftigt, welche Bedeutung Ausstellungen wie diese für die Geschichts- und Erinnerungskultur unserer Gesellschaft haben können. Im Fokus standen dabei insbesondere der moderne Geschichtsunterricht sowie die Nutzung der Ausstellung in diesem Kontext. „Kollektive Erinnerung ist immer ein Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen Positionen und Perspektive, Fragen und Deutungen. Er muss von jeder Generation gestaltet werden. Ausstellungen sind wichtige Orte der Information und des Austauschs dazu. Geschichtsunterricht muss zur Teilhabe daran befähigen“, erklärt Seminarleiter Prof. Dr. Andreas Körber, Professor für Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Didaktik der Geschichte und Politik. Am 30. August (19 Uhr) stellen die Studierenden im Vortragsraum der Stabi (Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg) ihre Arbeitsprozesse und Ergebnisse vor. Erarbeitet wurden zum Beispiel Beiträge für eine Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer, die theoretische Perspektiven auf die Ausstellung genauso enthält wie Vorschläge für ihre Thematisierung im Geschichtsunterricht und Möglichkeiten, sie barrierefrei zugänglich zu machen. Interessierte sind herzlich zur Präsentation und anschließenden Diskussion eingeladen. Eintritt frei.
+++
Staatsrätin besucht Hamburger Zentrum für Quantentechnologien
17. August. Dr. Eva Gümbel, Staatsrätin der Hamburger Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung und Bezirke, hat sich am Zentrum für Optische Quantentechnologien der Universität Hamburg über die hochaktuelle Forschung in diesem Bereich informiert. Im Fokus der Politikerin standen die Entwicklungen am Campus Bahrenfeld, insbesondere das Quantencomputer-Projekt „Rymax-One“. Seit Dezember 2021 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) das Projekt. Gemeinsam mit weiteren Beteiligten wollen die Hamburger Projektleiter in den kommenden Jahren einen Quantencomputer entwickeln, der reale Problemstellungen schneller berechnen kann als derzeitige Computer-Systeme. Das hätte Auswirkungen auf viele Wirtschaftszweige, etwa die Logistik oder Handy- und Energieversorgungsnetze. Mehr Information zum Besuch von Eva Gümbel finden Sie hier.
+++
Studierende der Uni Hamburg bei European University Games erfolgreich
1. August. Drei Studierende der Uni Hamburg traten bei den 6. European University Games (EUG) vom 17. bis 30 Juli 2022 an – und holten insgesamt fünf Medaillen. Damit führten sie mit der Universität Wuppertal und der DSHS Köln/Wettkampfgemeinschaft Köln den Medaillenspiegel der deutschen Hochschulen an. Besonders erfolgreich waren die Schwimmer der Uni Hamburg: Während Fynn Mohlfeld zwei Mal Silber und einmal Bronze gewann, sicherte sich Justin Bott neben einer Silbermedaille sogar eine der insgesamt drei deutschen Goldmedaillen. UHH-Studentin Celine Becker sicherte sich im Judo den fünften Platz und verpasste damit nur knapp die Bronzemedaille. Die EUG fanden im polnischen Lodz statt. Insgesamt nahmen fast 5.000 Studierende von mehr als 400 europäischen Hochschulen an den Spielen teil. Mehr Informationen gibt es auf der Seite des Hochschulsport: uhh.de/412ck
Kurzmeldungen September 2022
+++ Mehr als 600 Teilnehmende beim Lebensmittelchemikertag an der UHH +++ Tag der offenen Tür an der Sternwarte +++ Universität Hamburg mit einem Ausstellungsstück auf der Cap San Diego vertreten +++ Aufarbeitung der Bundeswehr-Mission in Afghanistan: Prof. Dr. Ursula Schröder in Enquete-Kommission berufen +++ Festveranstaltung zu Ehren von Salomo Birnbaum am 15.9. um 18 Uhr +++ Erstmals an der Universität Hamburg: Internationale Tagung zu Sprache im öffentlichen Raum +++ Förderung für europäisches Gesundheitsnetzwerk verlängert +++ Denkmaltag vom 9. bis 11.9.2022 – die Uni ist dabei! +++ Geschlecht und Vielfalt in der Forschung: HRA und ZGD an BMBF-gefördertem Projekt beteiligt +++
Mehr als 600 Teilnehmende beim Lebensmittelchemikertag an der UHH
27. September. Vom 19. bis 21. September hat der diesjährige Lebensmittelchemikertag in den Räumen des Fachbereichs Chemie der Universität Hamburg stattgefunden. Dabei gab es viel zu feiern: Nicht nur war es der 50. Lebensmittelchemikertag, die Lebensmittelchemische Gesellschaft kann in diesem Jahr auch auf ihr 75-jähriges Bestehen zurückblicken.
Einen ausführlichen Rückblick gibt es auf den Seiten des Fachbereichs.
+++
Tag der offenen Tür an der Bergedorfer Sternwarte
20. September. Am Samstag, 1. Oktober 2022, beginnt um 14 Uhr der Tag der offenen Tür an der Sternwarte. Besucherinnen und Besucher können selbst einmal durch das 1m-Spiegelteleskop schauen oder den Himmel mit dem Radioteleskop beobachten, Spektroskope basteln oder mit den Forschenden über den Urknall, schwarze Löcher und außerirdisches Leben diskutieren. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Sternwarte berichten außerdem über die Suche nach der Dunklen Materie oder den Weg der Sternwarte zum UNESCO-Welterbe. Kinder nehmen sie mit auf einen Spaziergang durch das Sonnensystem – oder zu den Lebensinseln verschiedener Tiere im Astronomiepark. Mitmachaktionen wie verschiedene Rallyes und Pflanzaktionen ergänzen das Angebot. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, Kaffee und Kuchen, Würstchen und Wokgemüse.
Der Eintritt ist frei, einige Angebote und Führungen finden auch auf Englisch statt. Ort: Gojenbergsweg 112, 21029 Hamburg. Mehr Informationen finden Sie hier.
+++
Universität Hamburg mit einem Ausstellungsstück auf der Cap San Diego vertreten
20. September. Mit einem Photobioreaktor mit lebender Algenkultur ist die Universität Hamburg in der Ausstellung Ocean Science (Multimedia Exhibition) auf dem Musaumsschiff Cap San Diego im Hamburger Hafen vertreten. Der Reaktor steht als Eyecatcher in der Ausstellung und ist ein biotechnologisches Beispiel zur Erzeugung von Algenbiomassen und regenerativer Energie. Prof. Dr. Dieter Hanelt vom Fachbereich Biologie hat das Ausstellungsstück beigesteuert. Er ist Vorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Meeresforschung und hat die Ausstellung mitorganisiert.
+++
Aufarbeitung der Bundeswehr-Mission in Afghanistan: Prof. Dr. Ursula Schröder in Enquete-Kommission berufen
19. September 2022. Fast 20 Jahre war die Bundeswehr im Hindukusch stationiert. Nun untersucht die Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ den Einsatz. Die vom Bundestag beauftragte Arbeitsgruppe bewertet die Mission in Gänze und arbeitet Handlungsempfehlungen für zukünftige Auslandseinsätze der Bundeswehr aus. Neben Bundestagsabgeordneten aus allen Fraktionen besteht die Enquete-Kommission aus zwölf Sachverständigen. Darunter ist auch eine Wissenschaftlerin der Uni Hamburg: Prof. Dr. Ursula Schröder, Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH).
+++
Festveranstaltung zu Ehren von Salomo Birnbaum am 15.9. um 18 Uhr
12. September 2022. Vor hundert Jahren gab er die ersten jiddischen Sprachkurse an der Hamburgischen Universität: Salomo Ascher Birnbaum (1891 – 1989). 21 Semester lang lehrte er nicht nur jiddische Sprache, sondern auch jiddische Literatur und Kultur. Mit seiner 1918 veröffentlichten jiddischen Grammatik und seiner 1922 erschienenen Dissertation über das Jiddische hatte er sich bereits einen Namen gemacht, dennoch verhinderten Mitglieder der Philosophischen Fakultät zweimal seine Habilitation. 1933 wurde Birnbaum von den Nationalsozialisten vertrieben und floh mit seiner Familie nach Großbritannien, wo er als Dozent für Paläographie und Epigraphik des Hebräischen sowie für Jiddisch tätig war.
Mit einer Festveranstaltung am 15. September um 18 Uhr im Hauptgebäude der Universität, Erwin-Panofsky-Hörsaal, Edmund-Siemers-Allee 1, soll an das Leben und die internationale wissenschaftliche Arbeit von Salomo Birnbaum erinnert werden. Veranstalter sind die Salomo-Birnbaum-Gesellschaft und die Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte in Kooperation mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden und dem Verein für Hamburgische Geschichte. Der Eintritt ist frei.

+++
Erstmals an der Universität Hamburg: Internationale Tagung zu Sprache im öffentlichen Raum
7. September 2022. Welchen Einfluss hat die Sprachlandschaft von Schulen und Universitäten auf die sprachliche und kulturelle Sozialisation von Schülerinnen und Schülern bzw. Studierenden? Und wie gestalten Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler oder Eltern die Sprachlandschaft an Schulen? Um ihre Forschung zu diesen und anderen Fragen vorzustellen, kommen vom 7. bis 9. September mehr als 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Afrika, Asien, Amerika und Europa an der Universität Hamburg zusammen. Der „Linguistic Landscape-Workshop“ ist die international wichtigste Fachveranstaltung zur Erforschung der Sprachlandschaft bzw. Sprache im öffentlichen Raum. Er findet 2022 – nach zweijähriger Unterbrechung aufgrund der Covid 19-Pandemie – erstmalig in Deutschland an der Universität Hamburg statt, wo die Linguistic Landscape-Forschung aktuell in der Fakultät für Geisteswissenschaften (Prof. Dr. Jannis Androutsopoulos) und in der Fakultät für Erziehungswissenschaft (Prof. Dr. Sílvia Melo-Pfeifer) vertreten ist.
+++
Förderung für europäisches Gesundheitsnetzwerk verlängert
6. September 2022. Seit 2021 ist die Universität Hamburg Mitglied im Europäischen Hochschulnetzwerk EUGLOH (European University Alliance for Global Health). Mit dem von der EU geförderten Projekt soll ein gemeinsamer europäischer Campus für Global Health geschaffen werden. Das Ziel von EUGLOH ist es, künftige Fachkräfte darauf vorzubereiten, forschungsorientierte Lösungsansätze für gesellschaftliche Fragestellungen in internationalen und interdisziplinären Teams zu erarbeiten. Die Förderung wurde jetzt um weitere vier Jahre bis Dezember 2026 verlängert. Unter der Federführung der Abteilung „Internationales“ koordiniert die Universität Hamburg zwei Arbeitspakete, an denen auch die Transferagentur beteiligt ist. Die Fördersumme der EU für die Universität Hamburg beträgt rund 1,9 Mio. Euro. Dem Netzwerk gehören aktuell neun Universitäten in acht Ländern an.
+++
Denkmaltag vom 9. bis 11.9.2022 – die Uni ist dabei!
5. September 2022. Geheime Gänge, Zeugnisse aus 100 Jahren Universitätsgeschichte oder fast 200 Abgüsse antiker Werke, deren Originale weltweit in Museen verteilt sind – beim diesjährigen Denkmaltag vom 9. bis 11.9. können Besucherinnen und Besucher das Hauptgebäude der Universität mit dem Unimuseum und die historische Gipsabguss-Sammlung des Archäologischen Instituts auf besondere Art erleben. Insgesamt umfasst das Programm des Denkmaltags rund 160 Möglichkeiten, Hamburgs Baukultur bei Führungen, Rundgängen und kulturellen Veranstaltungen kennenzulernen. Der Tag des offenen Denkmals der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wird in Hamburg von der Stiftung Denkmalpflege Hamburg und dem Denkmalschutzamt organisiert.
+++
Geschlecht und Vielfalt in der Forschung: HRA und ZGD an BMBF-gefördertem Projekt beteiligt
1. September 2022. Die Kategorie „Geschlecht“ wird in der Forschung oftmals nicht ausreichend berücksichtigt. Deswegen soll das Projekt “360° - Geschlecht und Vielfalt in der Forschung” dazu beitragen, Geschlechteraspekte verstärkt zu beachten. Das Projekt wurde im Rahmen der Förderlinie “Geschlechteraspekte im Blick” des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in der ersten Auswahlstufe ausgewählt. Die Hamburg Research Academy (HRA) und das Zentrum für Gender & Diversity (ZGD) entwickeln das Konzept für die Universität Hamburg und die Partnerhochschulen der beiden Einrichtungen. Ziel ist die Erarbeitung wirksamer Instrumente, mit denen insbesondere die Dimension Geschlecht in der Forschungsarbeit nachhaltig eingebettet werden kann. Die Angebote sollen sich an Forschende aller Karrierestufen und aller Disziplinen und auch an die Forschungsberatung richten.
In einem nächsten Schritt bewirbt sich das Projektteam mit dem Konzept beim Bundesministerium um eine fünfjährige Projektphase. Das Konzept wird in Zusammenarbeit mit interessierten Forschenden der beteiligten Hochschulen entwickelt, die sich mit Dr. Smillo Ebeling(smillo.ebeling"AT"uni-hamburg.de) in Verbindung setzen können. Sie verstärkt das Projektteam um Dr. Michaela Koch (ZGD) und Dr. Linda Jauch (HRA) bis Januar 2023.
Kurzmeldungen Oktober 2022
+++ Workshop zu Hamburgs Geschichte im Comic +++ Weil’s so schön war: Jan Delay bei „Get Back To Audimax!“ jetzt nochmal anschauen +++ Festveranstaltung „100 Jahre Frauen in juristischen Berufen“ am 1. November +++ Ergebnisse von Studie zu Internationalen Vorbereitungsklassen vorgestellt +++ Start der Ringvorlesung zu „Bewegung und Stadt“ +++ Warnung: Scam-Mails im Namen der Personalabteilung / Warning: Scam emails in the name of the HR department +++ Neuer Newsletter für die Bildungspraxis +++ DFG fördert Projekt zur Verbesserung des Risikomanagements bei Versicherungen +++ „Plastik in der Umwelt“ – ein Grundlagenbuch für Interessierte ab 12 Jahren +++ Zwei neue Dekanatsmitglieder an der Fakultät für Wirschafts- und Sozialwissenschaften +++ Förderung von Forschungsnetzwerken: Neue Ausschreibung der „Next Generation Partnerships“ +++ Veranstaltungsreihe „Poetry Debates II: Poesie und Technologie“ +++
Workshop zu Hamburgs Geschichte im Comic
25. Oktober. Comics sind nicht nur für die Jugendkultur ein wichtiges Medium, sie können auch ein wirksames Instrument zur Vermittlung von Geschichte sein. Um die Erschließung von Comics und Graphic Novels für die Hamburger Lokal- und Regionalgeschichte geht es im aktuellen Workshop, den die Universität Hamburg zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg anbietet und der das Hamburger Gängeviertel und seine bewegte Vergangenheit in den Blick nimmt.
Der Workshop, bei dem die Produktion eigener Comics im Fokus steht, richtet sich an Lehrkräfte, aber auch ganz allgemein an Comic-Interessierte. Er wird geleitet von der Illustratorin Sarah Gorf-Rohloff und dem Karikaturisten Jens Natter und findet statt am Donnerstag, den 24. November 2022, von 14 bis 18 Uhr im Gästehaus der Universität Hamburg (Rothenbaumchaussee 34). Weitere Informationen zu Organisation und Programm gibt es auf der Webseite des Arbeitsbereichs Public History. Anmeldungen sind bis zum 20. November 2022 möglich bei Prof. Dr. Thorsten Logge(thorsten.logge"AT"uni-hamburg.de).
+++
Weil’s so schön war: Jan Delay bei „Get Back To Audimax!“ jetzt nochmal anschauen
25. Oktober. Als am 15. September 2022, genau 50 Jahre nach Ottos legendärem Konzert im Audimax, Hamburger Musikgrößen an der Seite von Hamburgs Beatles-Expertin Stefanie Hempel und ihrer Band mit der Show „Get Back To Audimax!“ den größten Hörsaal der Uni erneut zum Beben brachten, war neben Otto Waalkes, Udo Lindenberg, Inga Rumpf, Annett Louisan oder Abi Wallenstein auch er dabei: Jan Delay. Für eine Doku hat 3sat den Musiker bei Auftritten und Proben begleitet und auch seinen Auftritt im Audimax mitgeschnitten. Unbedingt reinschauen!
Das Konzert im Audimax war der Auftakt einer Reihe, die sich mit der Hamburger Musikgeschichte befasst. Die Formate werden initiiert von Dr. Antje Nagel, Leiterin des Universitätsmuseums, und Prof. Dr. Thorsten Logge vom Arbeitsfeld Public History.
+++
Festveranstaltung „100 Jahre Frauen in juristischen Berufen“ am 1. November
24. Oktober. Erst seit 100 Jahren ist auch Frauen der Zugang zu Staatsexamen und damit zu juristischen Berufen möglich. Grundlage war das „Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen in der Rechtspflege“ vom 11. Juli 1922, für das der 1914 gegründete Deutsche Juristinnen-Verein (DJV) lange politisch gekämpft hatte. Anlässlich des 100. Jahrestages dieser Entscheidung findet an der Fakultät für Rechtswissenschaft am 1. November ab 17.30 Uhr die Festveranstaltung „100 Jahre Frauen in juristischen Berufen“ statt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Deutschen Juristinnenbund (djb), der als Nachfolgeorganisation des DJV den Jahrestag deutschlandweit an historisch wichtigen Universitäten mit Veranstaltungen begeht, bei denen der Beitrag von Juristinnen im 20. Jahrhundert zu Rechtsstaat und Demokratie gewürdigt, aber auch die aktuelle Situation der Gleichstellung kritisch in den Blick genommen wird. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Zusätzlich gibt es ab dem 27. Oktober bis zum 2. November in der Zentralbibliothek Recht (Rothenbaumchaussee 33, 4. OG) eine ausführliche Ausstellung zum Thema.
+++
Ergebnisse von Studie zu Internationalen Vorbereitungsklassen vorgestellt
19. Oktober. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine steigt derzeit die Zahl der geflüchteten Schülerinnen und Schüler, die in Deutschland in unterschiedlichen Klassenstufen in das Regelschulsystem einsteigen. In Hamburg kommen diese Kinder und Jugendlichen zunächst in sogenannte Internationale Vorbereitungsklassen (IVK), bevor sie in Regelklassen wechseln. Für die Schulen ist die Gestaltung dieses Übergangs daher ein zentrales Thema. Ein Forschungsteam der Universität Hamburg um Prof. Dr. Sara Fürstenau, Dr. Elisabeth Barakos und Dr. des. Simone Plöger von der Fakultät für Erziehungswissenschaft hat mit dem Projekt „SpraBÜ – Sprachliche Bildung am Übergang von Vorbereitungs- zu Regelklasse“ Stadtteilschulen mit IVK in Hamburg begleitet. Dabei interessierte die Forscherinnen besonders, wie Schulen in Hamburg ihre Sprachbildungsangebote für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler an diesem Übergang gestalten. Die Ergebnisse der Studie liegen jetzt vor. Ein Ergebnis ist, dass zwischen offiziellen Vorgaben für die IVK wie der Klassengröße und den vorhandenen Strukturen ein Dilemma besteht, das u. a. zu erhöhter Arbeitsbelastung der Lehrkräfte führt und sich negativ auf die Übergänge der Kinder auswirkt, die verfrüht oder auch verspätet in Regelklassen wechseln. Die Forscherinnen, die die Ergebnisse auch in verschiedenen Formaten mit der Praxis diskutieren, empfehlen daher zum Beispiel, dass neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler umgehend in Regelklassen kommen und begleitend dazu Sprachförderung erhalten. Mehr Informationen, besonders auch zu den Auswirkungen der Pandemie auf die IVK, gibt es in der aktuellen Publikation des Projektes.
+++
Start der Ringvorlesung zu „Bewegung und Stadt“
17. Oktober. Hamburg trägt seit dem Jahr 2018 den Titel „Global Active City“. Damit will der Hamburger Senat die Großstadt zu einer gesunden und bewegungsfördernden Umgebung für alle gestalten. Die wissenschaftliche Unterstützung dafür kommt vom Arbeitsbereich „Sport- und Bewegungsmedizin“ des Instituts für Bewegungswissenschaft unter der Leitung von Dr. Nils Schumacher. Mit der Ringvorlesung „Bewegung und Stadt: Was macht Hamburg zu Global Active City?“ wird das Thema nun für Studierende sowie für interessierte Hamburgerinnen und Hamburger aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Zum Auftakt am 18.10. wird Christoph Holstein, Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport, die Großstadtstrategie Active City vorstellen. Weitere Themen sind die Rolle des organisierten Sports in der Bewegungs- und Gesundheitsförderung, eine bewegungsfreundliche Stadtplanung oder die Bedeutung von epidemiologischen Studien. Die Vorlesungen finden statt am 18.10., 08.11., 22.11., 06.12., 10.01., 24.01. und 31.01. (jew. 18:30 bis 20 Uhr) im Hauptgebäude der Universität an der Edmund-Siemers-Allee 1 (Hörsaal B). Der Eintritt ist frei. Das vollständige Programm der Vorlesung ist auf der Seite des Instituts für Bewegungswissenschaft abrufbar.
+++
Warnung: Scam-Mails im Namen der Personalabteilung / Warning: Scam emails in the name of the HR department
11. Oktober. Die Personalabteilung warnt vor Scam-Mails, die in ihrem Namen verschickt werden. Sie stammen von der Absender-Adresse „jobs@universitat-hamburg.de“ und enthalten angebliche Stellenangebote für Englischlehrerinnen und -lehrer. Zudem wird mitunter zu Zahlungen aufgefordert. Die Personalabteilung weist darauf hin, dass diese E-Mails nicht von der Universität Hamburg versendet werden. Betroffene Empfängerinnen und Empfänger sollten nicht auf diese E-Mails antworten und keine Zahlungen leisten, sondern die Nachricht umgehend löschen. Hinweise auf die Absender dieser E-Mails bitte an die Personalabteilung, damit umgehend die Polizei verständigt werden kann. Find an English version of this notice on the HR department website.
+++
Neuer Newsletter für die Bildungspraxis
11. Oktober. Wie kann Künstliche Intelligenz die Unterrichtsplanung verbessern? Warum ist sprachliche Bildung auch ein Thema im Physikunterricht? Und welche Transferprojekte laufen derzeit in der Fakultät für Erziehungswissenschaft? Dies sind nur einige der Themen in der ersten Ausgabe vom „N[EW]sletter - Forschungsperspektiven der EW“, mit dem die Fakultät ab sofort ihren Service erweitert.
Der Newsletter bietet Neuigkeiten und Einblicke in die Forschung, Impulse für die Praxis sowie Perspektiven auf aktuelle bildungswissenschaftliche Themen. Neben aktuellen Folgen vom Podcast „Bildungsschnack“ gibt es auch Interviews mit jungen Forschenden sowie Hinweise auf Materialien. Ein besonderes Format ist „Praxis fragt Wissenschaft“, in dem Erziehungswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler die Fragen der Leserinnen und Leser beantworten.
Der Newsletter richtet sich vor allem an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der Bildungspraxis, an Journalistinnen und Journalisten sowie Interessierte aus Schule, außerschulischer Praxis und Erwachsenenbildung. Die Anmeldung zum Newsletter ist online möglich.
+++
DFG fördert Projekt zur Verbesserung des Risikomanagements bei Versicherungen
11. Oktober. In der Schadenversicherungsbranche stellen insbesondere die Schadenrückstellungen oftmals einen der größten versicherungstechnischen Passivposten in der Bilanz und damit auch einen der größten Risikotreiber dar, weshalb einer adäquaten Bestimmung von Schadenreserven (der sogenannten Schadenreservierung) eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Daher ist die Prognose dieser Verbindlichkeiten und die Quantifizierung ihrer Unsicherheit ein zentrales versicherungsmathematisches Thema. Für die Bestimmung von Schadenreserven gibt es unterschiedliche Modelle – eines der verbreitetsten ist das Chain-Ladder-Verfahren.
Dr. Nataliya Chukhrova und Dr. Arne Johannssen vom Institut für Mathematik und Statistik der Fakultät für Betriebswirtschaft wollen in ihrem Projekt „Extending the Chain Ladder Method for Actuarial Practice“ dieses Verfahren der Schadenreservierung untersuchen und neue Techniken der Datenwissenschaften zu seiner Verbesserung entwickeln. Ziel ist, die Kalkulation der Schadenreserven auf Grundlage einer plausibleren Basis zu ermöglichen, um so das Risikomanagement von Versicherungsunternehmen verbessern zu können. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Projekt mit einer Summe von rund 100.000 Euro.
+++
„Plastik in der Umwelt“ – ein Grundlagenbuch für Interessierte ab 12 Jahren
10. Oktober. „Woher kommt das Plastik im Meer?“ – diese Frage beantworteten Elena Hengstmann und Matthias Tamminga vom Institut für Geographie vor einiger Zeit im Rahmen einer Vorlesung der Kinderuni. Jetzt ist daraus ein Buch geworden, das die Grundlagen der Thematik für eine Zielgruppe von Interessierten ab 12 Jahren allgemeinverständlich aufbereitet. Dabei geht es auch um Fragen, was Kunststoffe und Polymere eigentlich sind, welche Folgen Plastik in der Umwelt haben kann und wie wir dem entgegenwirken können. Das Buch ist im Springer-Spektrum-Verlag erschienen und als Download sowie als Softcover erhältlich.
+++
Zwei neue Dekanatsmitglieder an der Fakultät für Wirschafts- und Sozialwissenschaften
4. Oktober. Zum Monatsbeginn begrüßt die Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zwei neue Mitglieder im Dekanat: Prof. Dr. Vera Troeger und Dr. Stephan Michel. Prof. Troeger übernimmt das Amt der Prodekanin für Studium und Lehre und tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Katharina Kleinen-von Königslöw an. Die Prodekaninnen oder Prodekane werden auf Vorschlag der Dekanin oder des Dekans vom Fakultätsrat für eine Amtszeit von drei bis fünf Jahren gewählt. Dr. Michel ist neuer Verwaltungsleiter der Fakultät. Er bildet gemeinsam mit Prof. Troeger sowie Prof. Dr. Cord Jakobeit (Dekan), Prof. Dr. Alexander Szimayer (Prodekan für Forschung) und Prof. Dr. Andreas Lange (kooptiertes Mitglied) das Dekanat der Fakultät.
Förderung von Forschungsnetzwerken: Neue Ausschreibung der „Next Generation Partnerships“
4. Oktober. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Exzellenzuniversität Hamburg beim Ausbau und der Weiterentwicklung nachhaltig angelegter multilateraler und forschungsstarker Netzwerke zu unterstützen, das ist das Ziel des Förderprogramms „Next Generation Partnerships (NGP) – Thematische Netzwerke“. Die zweite Ausschreibung des Förderprogramms wurde jetzt veröffentlicht. Anträge können bis zum 13. November 2022 gestellt werden. Das Antragsformular sowie alle Informationen zu Antragstellung, Auswahlkriterien, Fördermitteln und Pflichten finden sich auf den Seiten der Abteilung Internationales.
Das Programm NGP gehört zu mehr als zwanzig Einzelvorhaben, die die Universität Hamburg mit den Mitteln der Exzellenzstrategie in fünf zentralen Dimensionen (Forschung, Lehre, Transfer, Forschungsinfrastruktur und Internationalisierung) verwirklicht.
+++
Veranstaltungsreihe „Poetry Debates II: Poesie und Technologie“
Auch die Lyrik kann sich im digitalen Zeitalter nicht dem Einfluss von Technologie verschließen. Auf diese Weise entstehen neue Formen performativer, musikalischer oder visueller Lyrik, die avancierte Technologien aufgreifen. Die Veranstaltungsreihe „Poetry Debates II: Poesie und Technologie“ bringt vom 26. Oktober bis 7. Dezember 2022 Akteurinnen und Akteure aus Dichtung, Performance und Wissenschaft zusammen, um unterschiedliche Positionen zu diesem Thema zu debattieren.
Die Reihe wird vom Forschungsprojekt „Poetry in the Digital Age“ unter der Leitung von Prof. Dr. Claudia Benthien veranstaltet. Im Projekt werden zeitgenössische Lyrik und ihre medialen Präsentationsformen untersucht. Es wird durch einen Advanced Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC) gefördert.
Das Programm und sowie weitere Informationen finden sich auf der Website des Projekts. Die vier öffentlichen Events finden auf Deutsch und z.T. auf Englisch (mit Übersetzung) statt. Der Eintritt ist frei.
Kurzmeldungen November 2022
+++ „Zukünfte der Nachhaltigkeit“: Fünfter Band der Buchreihe erschienen +++ NDR-Beitrag: 100 Jahre Universitäts-Gesellschaft +++ Aus PIER Hamburg wird PIER PLUS +++ Mitglieder der Universität in Hamburger Akademie der Wissenschaften gewählt +++ Norddeutscher Wissenschaftspreis für Verbundprojekt CIMMS +++ UN-Nachhaltigkeitsziele: Neuer Wettbewerb gestartet +++ Materialplattform für das Grundschullehramt Deutsch veröffentlicht +++ Jetzt als Video online: „Vorlesung für alle“ mit Unipräsident Prof. Dr. Hauke Heekeren +++ 84. Jahrestag der Reichspogromnacht: Mahnwache im Grindelviertel +++ DFG-Podcast „Exzellent erklärt“ – neue Folge zu „Dark Matter“ +++
„Zukünfte der Nachhaltigkeit“: Fünfter Band der Buchreihe erschienen
24. November. Der Klimawandel, das Artensterben, globale Migrationsbewegungen und zunehmende politische Gewalt sind nur einige der zahlreichen Herausforderungen unseres Zeitalters. Sie führen zu einer Ungewissheit, die das Zusammenleben, das Mensch-Natur-Verhältnis und unsere Vorstellung von Zukunft stark beeinflusst und zum Teil infrage stellt. Die neue Publikation „Praxis und Ungewissheit. Zur Alltäglichkeit sozial-ökologischer Krisen“ der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Kolleg-Forschungsgruppe „Zukünfte der Nachhaltigkeit“ versammelt Beiträge, die sich aus einer praxistheoretischen Perspektive mit dem Spannungsfeld von umkämpften Zukünften und Ungewissheit vor dem Hintergrund der Allgegenwärtigkeit sozial-ökologischer Krisen auseinandersetzen. Es ist der fünfte Band der Buchreihe „Zukünfte der Nachhaltigkeit“.
+++
NDR-Beitrag: 100 Jahre Universitäts-Gesellschaft
21. November. Nur drei Jahre nach der Gründung der Hamburgischen Universität wurde 1922 die „Gesellschaft der Freunde der Hamburgischen Universität“ ins Leben gerufen. Ihr Ziel war es, „ein Zusammenwirken der Universität mit dem hamburgischen Bürgertum, insbesondere auch der hamburgischen Kaufmannschaft zum Nutzen sowohl der Wissenschaft als auch der praktischen Berufe herbeizuführen.“ Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Einrichtung, die heute „Universitäts-Gesellschaft“ heißt und von Persönlichkeiten aus Universität, Wirtschaft und öffentlichem Leben ehrenamtlich getragen wird, hat das „Hamburg Journal“ einen interessanten Beitrag zu ihrer Geschichte und den aktuellen Aktivitäten veröffentlicht. Er ist auf den Seiten des NDR abrufbar.
+++
Aus PIER Hamburg wird PIER PLUS
21. November. PIER (Partnership for Innovation, Education and Research), die strategische Partnerschaft zwischen dem Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY und der Universität Hamburg in der Science City Bahrenfeld, wird weiterentwickelt. Im Rahmen von PIER wurden seit 2011 erfolgreich Forschungsprojekte und Innovationen sowie die Ausbildung von exzellentem wissenschaftlichen Nachwuchs gefördert. Jetzt wird es unter Koordination der Universität Hamburg als Flagship der Metropolregion weitere Kooperationen in einer konzertierten strategischen Partnerschaft unter dem Namen PIER PLUS geben.
Neben dem Profil „PIER Science City hamburg Bahrenfeld“ wird PIER PLUS aus fünf weiteren Profilen bestehen: „PIER Infektion und Gesundheit“, „PIER Klima und Küste“, „PIER Konflikt und Koordination“, „PIER Klimafreundliche Mobilität“ und „PIER Neue Materialien“. Die Webseite von PIER PLUS mit allen Informationen zu den federführenden und kooperierenden Institutionen ist ab sofort online.
+++
Mitglieder der Universität in Hamburger Akademie der Wissenschaften gewählt
21. November. Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat acht neue ordentliche Mitglieder gewählt, darunter ein Wissenschaftler und zwei Wissenschaftlerinnen der Universität Hamburg: Prof. Dr. Philippe Depreux vom Arbeitsbereich Mittelalterliche Geschichte und Leiter des Langzeitvorhabens „Formulae – Litterae – Chartae“ (2017-2031) im Akademienprogramm, Prof. Dr. Anita Engels vom Fachbereich Sozialwissenschaften und Sprecherin des Clusters „Climate, Climatic Change, and Society (CLICCS) sowie die Molekularbiologin Prof. Dr. Blanche Schwappach-Pignataro, Dekanin der Medizinischen Fakultät an Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).
Der Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist in interdisziplinären Arbeitsgruppen organisiert. Ihr gehören herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Disziplinen aus Norddeutschland an. Sie trägt dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen Fächern, Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Institutionen zu intensivieren.
+++
Norddeutscher Wissenschaftspreis für Verbundprojekt CIMMS
16. November. Das Verbundprojekt „CIMMS“ („Center for Integrated Multiscale Materials Systems“), an dem auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg beteiligt sind, hat den mit 150.000 Euro dotierten Norddeutschen Wissenschaftspreis erhalten. Das Projekt unter Federführung der Technischen Universität Hamburg vernetzt in einem bundesweit einzigartigen Forschungsansatz die überregionale Forschung im Bereich Materialwissenschaft. Beteiligt sind außerdem das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) und das Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG). Ziel des CIMMS ist die Herstellung einer Materialbasis mittels 3D-Druck, um kostengünstigere und langlebigere Produkte mit neuartigen Funktionen zu entwickeln. Projektkoordinator der Universität Hamburg ist Prof. Dr. Michael Fröba aus dem Fachbereich Chemie.
Der Norddeutsche Wissenschaftspreis wurde 2012 eingerichtet und prämiert länderübergreifende Kooperationen in der Wissenschaft, die sich durch wissenschaftliche Exzellenz auszeichnen und durch ihren Erfolg einen Beitrag zur Stärkung und Wettbewerbsfähigkeit norddeutscher wissenschaftlicher Netzwerke leisten.
+++
UN-Nachhaltigkeitsziele: Neuer Wettbewerb gestartet
16. November. Studierende und Promovierende können ab sofort am Wettbewerb zum UN-Nachhaltigkeitsziel 16 – „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ – teilnehmen. Sie können sich mit einem Video/Vlog, einem Podcast oder einem wissenschaftlichen Poster bewerben und damit einen Beitrag zur Entwicklung hin zu friedlichen und inklusiven Gesellschaften leisten. Der Wettbewerb im Rahmen eines internationalen Netzwerks wird bereits zum dritten Mal ausgeschrieben. Die Beiträge können bis zum 15. Januar 2023 per E-Mail(sdg-poster-competition.pv"AT"uni-hamburg.de) eingereicht werden. Zu gewinnen gibt es Reisestipendien von bis zu 1.000 Euro.
Der Wettbewerb findet parallel auch an sechs Partnerhochschulen statt. Sie organisieren im Anschluss an den Wettbewerb ein gemeinsames virtuelles Forum: das Global Partners Research Forum. Dort erhalten ausgewählte Gewinnerinnen und Gewinner der Universität Hamburg und der Partnerhochschulen die Möglichkeit, ihre Beiträge zu präsentieren.
Die 17 Sustainable Development Goals/Nachhaltigkeitsziele sind Zielsetzungen der Vereinten Nationen (UN), die die Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene beinhalten.
+++
Materialplattform für das Grundschullehramt Deutsch veröffentlicht
3. November. Studierende und Lehrende im Grundschullehramtsstudiengang Deutsch können jetzt auf eine neue Plattform mit umfangreichem Lehrmaterial zugreifen. Eine Arbeitsgruppe aus der germanistischen Linguistik, der Literaturwissenschaft und der Fachdidaktik Deutsch hat diese in den vergangenen zwei Jahren zusammengestellt, um niedrigschwellig Materialien für den Einsatz in der Lehre verfügbar zu machen. Die Materialien aus dem Kontext Schule sollen im Rahmen der universitären Grundschullehramtsausbildung im Fach Deutsch in den Teilbereichen Didaktik, Linguistik und Literaturwissenschaft eingesetzt werden können. Ziel ist es, die Kooperation zwischen den Fachwissenschaften und der Fachdidaktik im Lehramtsstudium zu erleichtern sowie den Studierenden die Relevanz des fachlichen Wissens für die spätere Lehrtätigkeit zu verdeutlichen. Die Plattform umfasst Downloadmaterialien inklusive fachwissenschaftlicher Kommentierungen und didaktischer Hinweise und steht allen interessierten Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung.
+++
Jetzt als Video online: „Vorlesung für alle“ mit Unipräsident Prof. Dr. Hauke Heekeren
2. November. Auto oder Fahrrad? Kaffee oder Tee? Das Leben stellt uns jeden Tag vor Entscheidungen. Wie genau diese Entscheidungsfindung im menschlichen Gehirn funktioniert, hat Universitätspräsident Prof. Dr. Hauke Heekeren bei seiner diesjährigen „Vorlesung für alle“ thematisiert. Auf dem Schwimmkran „Karl Friedrich Stehen“ im Museumshafen Oevelgönne erklärte der Arzt und Neurowissenschaftler zudem, warum das Wissen darum, wie wir Dinge bewerten und wie wir Entscheidungen treffen, so wichtig ist. Wer den Vortrag von Prof. Heekeren verpasst hat, kann ihn nun noch einmal als Video online ansehen. Die Veranstaltung war Teil der Reihe „Vorlesung für alle“, bei der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg den Hörsaal mit einem eher ungewöhnlichen Ort tauschen und sich mit ihren Vorträgen an alle Bürgerinnen und Bürger richten. Alle Informationen zu den kommenden Terminen gibt es auf der „Vorlesung für alle“-Webseite.
+++
84. Jahrestag der Reichspogromnacht: Mahnwache im Grindelviertel
2. November. Gegen das Vergessen und für eine gemeinsame Zukunft in Frieden: Am Mittwoch, den 9. November 2022, findet um 15.30 Uhr auf dem Joseph-Carlebach-Platz (Grindelhof 25) eine Mahnwache zur Erinnerung an die Reichspogromnacht 1938 statt. Damals wurden in Deutschland und Österreich Synagogen sowie jüdische Geschäfte und Wohnhäuser zerstört. Auch in Hamburg wurden Jüdinnen und Juden bedroht, gedemütigt und verletzt, viele wurden in Konzentrationslager verschleppt. 84 Jahre danach wird an dem Ort, an dem 1938 die Bornplatz-Synagoge angezündet wurde, der Opfer des Pogroms gedacht. Auch Universitätspräsident Prof. Dr. Hauke Heekeren wird in einer Rede an die damaligen Ereignisse erinnern. Zudem sprechen Historikerin Prof. Dr. Ursula Büttner, UKE-Medizinhistorikerin PD Dr. Rebecca Schwoch, Autorin Dr. Regula Venske, Sophie Lierschof vom Auschwitz-Komitee und Galina Jarkova von der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hamburg.
Veranstaltet wird die Mahnwache von der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Hamburg“, der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hamburg und der Universität Hamburg. Im Anschluss startet die Aktion „Grindel leuchtet“, bei der die Stolpersteine, die an die ermordeten jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner des Grindelviertels erinnern, mit Kerzen geschmückt werden.
+++
DFG-Podcast „Exzellent erklärt“ – neue Folge zu „Dark Matter“
1. November. Der Großteil unseres Universums besteht aus der sogenannten Dunklen Materie – ein Stoff, der unsichtbar ist und gleichzeitig Galaxien zusammenhält. In der neuen Folge des Podcasts „Exzellent erklärt“ zum Dark Matter Day am 31. Oktober sprechen der Astrophysiker Prof. Dr. Marcus Brüggen und die Teilchenphysikerin Prof. Dr. Erika Garutti vom Exzellenzcluster Quantum Universe mit Moderatorin Larissa Vassilian darüber, was Dark Matter eigentlich ist, woher wir wissen, dass es sie geben muss, woraus sie besteht und wie Forschende nach ihr suchen.
„Exzellent erklärt“ ist ein Podcast der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Er berichtet regelmäßig aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Das Format startete im September 2021 und will aktuelle Spitzenforschung in die breite Öffentlichkeit vermitteln. Zu den bisherigen Themen gehörte auch ein Beitrag des Exzellenzclusters „CLICCS“: „Klimawandel – sind 1,5 Grad noch plausibel?“. Alle Podcast-Folgen sind online abrufbar.