Wenn Professor Tom ein Quiz gewinnt – Wie man spontane Urteilsbildung erforschtSerie Forschen und Verstehen
1. September 2025, von Anna Priebe

Foto: iStock/wildpixel
Selbst wenn wir lesen, wie sich ein Mensch verhalten hat, bilden wir uns oft in Sekunden ein Urteil. Welche Mechanismen dabei ablaufen und welche Informationen unsere Bewertung beeinflussen, erforschen Prof. Dr. Juliane Degner und Jana Mangels am Arbeitsbereich Sozialpsychologie.
Wir haben uns vor wenigen Minuten zu diesem Interview zusammengesetzt. Wie schnell haben wir uns gegenseitig Eigenschaften zugeschrieben, als wir uns gesehen haben?
Degner: Die ersten Eindrücke sind in Sekundenbruchteilen entstanden. Das sind ganz basale Bewertungen im Sinne von: Das ist eine Person, die vertrauenswürdig und nicht gefährlich ist. Zudem haben wir ganz automatisch Kategorisierungen vorgenommen, zum Beispiel nach Geschlecht und Alter – und haben damit Ähnlichkeiten und Unterschiede zu uns etabliert. Diese allerersten Eindrücke passieren, ohne dass wir es uns vornehmen müssen. Und wir brauchen dazu keine besondere Aufmerksamkeit.
Welche Quellen und Informationen nutzen wir für diese Urteile?
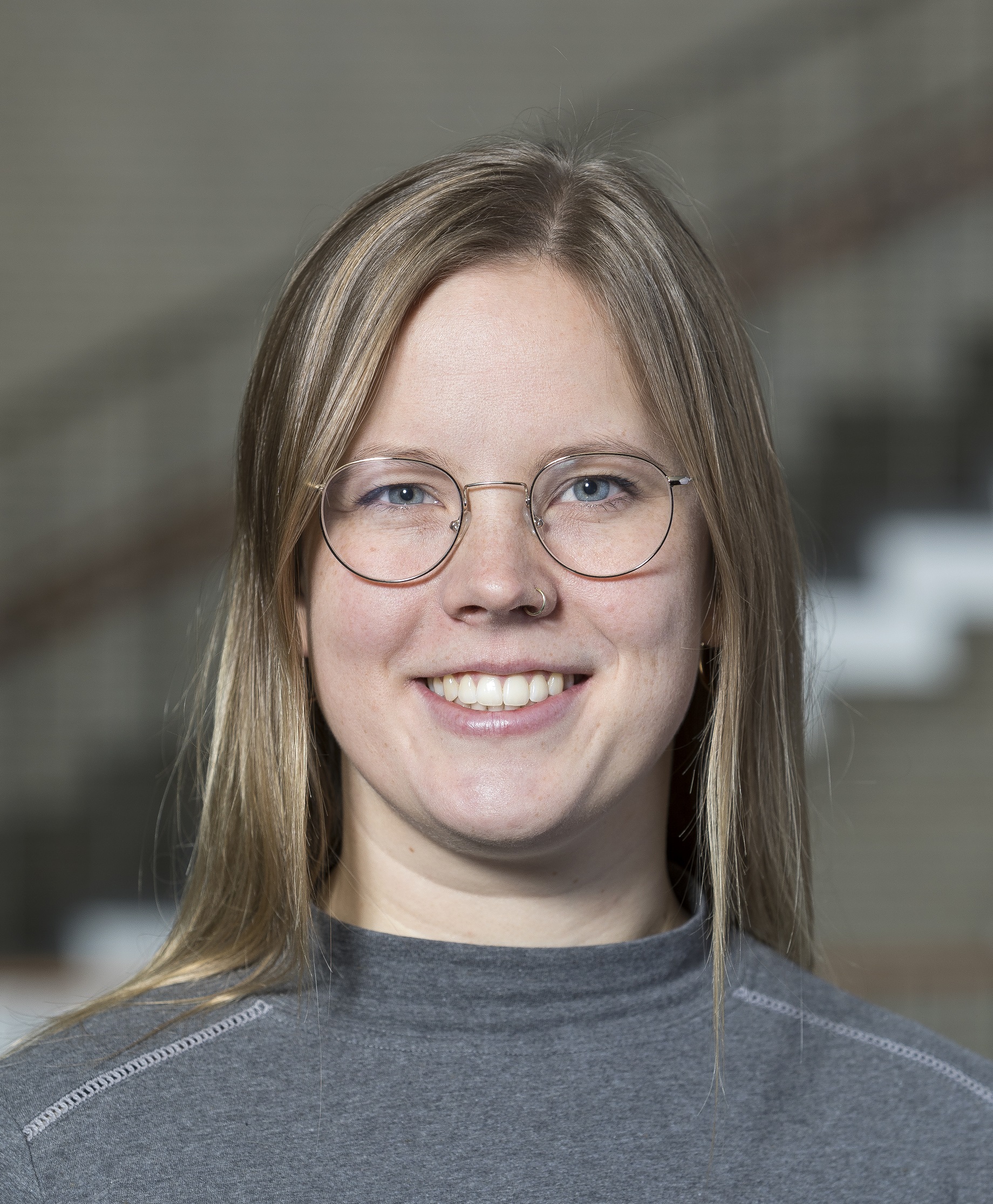
Mangels: Es gibt sehr interessante Forschung dazu, wie wir Informationen aus einer Quelle nutzen. Das sind zum Beispiel das Gesicht oder die Stimme. Es gibt aber nicht so ganz viele Erkenntnisse dazu, was wir machen, wenn sich diese Eindrücke widersprechen. Es gibt zudem die Möglichkeit, dass ich vorab schon Informationen über eine Person habe. Zum Beispiel haben wir uns vor dem Zoom-Meeting E-Mails geschrieben, die man als Minimalindikator für Verhalten sehen kann.
Degner: Wichtige Zusatzinformationen sind auch das, was wir „Residue of behavior“ nennen, also etwas, das entstanden ist, weil man sich verhalten hat. Das kann zum Beispiel der Raum im Hintergrund des Zoom-Ausschnitts oder der Schreibtisch einer Person sein. Im Vergleich zum Aussehen sind das eigentlich ganz gute Indikatoren dafür, wie eine Person ist. Wir verlassen uns aber zum Beispiel viel darauf, ob jemand lächelt oder nicht. Wir vergessen, dass es sehr starke kulturelle Normen gibt, wann wir wie zu lächeln haben – und an die halten sich die meisten Menschen auch. Das heißt, das Lächeln ist eigentlich von der Situation vorgegeben und gar nicht so informativ über eine Person.
Welche Informationen interessieren Sie in Ihrer Forschung?

Degner: Ein Forschungsstrang bei uns beschäftigt sich mit Kategorisierungen – also ob ich etwa eine Geschlechtskategorisierung vornehme und wie das die weitere Informationsverarbeitung beeinflusst. Das geht stark in den Bereich Stereotypenforschung und wir arbeiten hier viel mit Gesichtern, aber auch mit verbalen Informationen wie Namen oder Labeln in Form von Berufsbezeichnungen. Eine andere Forschungsrichtung ist das Urteil auf Basis von Berichten über Verhalten.
Mangels: Das ist der Fokus meiner Promotion. Mein Team interessiert, ob und wie Verhaltensbeschreibungen wie ‚Tom gewinnt ein Quiz‘ die Meinung der Proband:inn:en über die Person – in diesem Fall Tom – beeinflussen. Typischerweise wäre das, dass Tom schlau ist, da er das Quiz gewonnen hat. Wir ergänzen dann zusätzlich soziale Kategorien und Label, um herauszufinden, ob sich die Eindrücke verändern. Macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob Tom Professor ist? Die bisher publizierte Forschung sagt, dass das eine Rolle spielt. Wir konnten das bisher aber nicht bestätigen. Daher schauen wir ganz genau in die Details, auf die Art des Materials und in die Aufgabenstellung, um herauszufinden, wo wir Effekte finden.
Wie untersucht man so unbewusste Prozesse?
Mangels: Der Fokus unserer Forschung sind spontane Eindrücke. Das bedeutet, wir gehen davon aus, dass es einen Unterschied machen kann, ob ich explizit danach gefragt werde, wie ich Tom finde. Es könnte ja theoretisch sein, dass ich den Satz über Toms Quiz-Erfolg lese und gar nichts über Tom denke, sondern Tom nur beurteile, wenn und weil ich danach gefragt werde. Wir wollen das umgehen, indem wir indirekte Messmethoden verwenden.
Die Proband:inn:en sehen hintereinander viele verschiedene Sätze, von denen sich einer auf Tom bezieht. Irgendwann werden sie gefragt, ob das Wort ‚schlau‘ in dem Satz über Tom vorkam. Sie müssen dann schnell zwischen ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ entscheiden. Die richtige Antwort ist ‚Nein‘, aber es fällt ihnen beim Wort ‚schlau‘ schwerer, diese Antwort zu geben, weil sie sich das quasi mitgedacht haben. Das machen wir wiederholt und mit verschiedenen Kontrollwörtern wie ‚nett‘. So können wir indirekt darauf schließen, was die Teilnehmenden aus der Beschreibung eines Verhaltens erschlossen haben.
Degner: Der Kern dieser Forschung ist wirklich die Trennung zwischen absichtlicher und spontaner Eindrucksbildung. Die Annahme ist, dass wir im Alltag sehr oft eher spontan urteilen und erst hinterher anfangen zu rationalisieren. Dieser indirekte Zugang kommt aber mit Schwierigkeiten, denn man interpretiert sehr viel. Was man misst, sind Tastendrücke und Reaktionszeiten, die man erst erschließen muss. Und man muss natürlich eine gute Theorie haben, wie die Ergebnisse mit einem Eindruck assoziiert sind. Hier geht es oft um Millisekunden.
Uns interessierten vor allem die sozialen Gruppenlabel
Wie findet man die richtigen Sätze, um die Wirkung der Beschreibungen zu testen?
Mangels: Wir haben mit einem mehrschrittigen Verfahren versucht, die Sätze so allgemeingültig wie möglich zu machen. Da uns vor allem die sozialen Gruppenlabel interessieren, haben wir im ersten Schritt ganz viele Leute nach Eigenschaften zu verschiedenen Labeln gefragt, also etwa zu Professorinnen oder Bankberatern. Dann haben wir den Menschen Eigenschaften wie ‚schlau‘ genannt und gefragt, welche Verhaltensweisen diese für sie implizieren. In jeder Stufe haben wir uns die Beispiele herausgepickt, auf die sich die meisten Befragten einigen konnten.
Weiß man schon, was mit diesen ersten Eindrücken passiert bzw. wie sie sich in Verhalten übertragen?
Degner: Empirische Untersuchungen zur Relevanz dieser ersten Eindrücke sind eher knapp. Diese Studien zeigen aber: Wenn ich einen ersten Eindruck von Tom habe und gefragt werde, was Tom wohl morgen macht, ist die Antwort in der Regel kongruent mit dem ersten Eindruck. Es gibt auch Forschung, die zeigt, dass wir nach diesen ersten Eindrücken entscheiden, ob wir mit der Person interagieren möchten. Wir wissen aber ehrlich gesagt noch nicht sehr viel darüber, wie lange diese spontanen ersten Eindrücke bestehen bleiben und wie stark sie wirken. Die Stereotypenforschung – bei der es nicht um individuelle, verhaltensbasierte Urteile geht, sondern um gruppenbasierte Zuschreibungen wie Mann/Frau, nah/fremd – zeigt allerdings, dass diese Urteile starke Auswirkungen auf die Erwartungsbildung haben können.
Sie haben in Ihrer Forschung zur Wirkung von Verhaltensbeschreibung bisher keine Auswirkungen solcher sozialen Gruppenlabel gefunden. Ist das ein Widerspruch?
Mangels: Nein, denn die These ist, dass unsere Forschung zu den Beschreibungen sehr frühe Prozesse in der Urteilsbildung widerspiegelt. Es könnte sein, dass Stereotype dort noch keine große Rolle spielen. Aber die Eindrucksbildung ist ein fortlaufender Prozess und in späteren Phasen spielen Stereotype dann eine große Rolle. Etwa, wenn ich mir nicht mehr ganz sicher bin, was zu einer Person gesagt wurde.
Degner: Aus rein kognitiver Sicht dienen Stereotype genau dazu. Eigentlich wissen wir, dass wir Menschen nur aufgrund ihrer individuellen Eigenschaften beurteilen sollten. Aber wenn wir wenig Informationen haben, greifen wir auf Gruppenzuschreibungen zurück. Wenn ich beobachte, wie Tom sich verhält, dann kann ich diese Information nutzen. Aber später habe ich das vielleicht vergessen oder bin mir nicht mehr sicher. Theoretisch müsste ich dann sagen: Ich weiß gar nichts über Tom und kann mir kein Urteil bilden. Aber unser Gehirn sagt dann: Moment, der gehörte doch zu Kategorie A – und wir wissen doch, was typisch für die ist. Mit diesem Wissen fülle ich die Leerstelle auf und kann mich schnell gegenüber Tom verhalten.
Wie können die Erkenntnisse aus Ihrer Forschung genutzt werden?
Mangels: Wir machen Grundlagenforschung und wollen die Mechanismen und Abläufe verstehen, um daraus Schlüsse zu ziehen. Auch, wenn wir jetzt vielleicht noch nicht ganz genau wissen, was diese Schlüsse sein werden, gibt es durchaus erste Überlegungen dazu, wie man Wissen über Prozesse der Eindrucksbildung nutzen könnte, um die Beurteilungsfähigkeit zu trainieren.
Degner: Das ist in verschiedenen Bereichen hoch relevant, etwa in Bewerbungsprozessen und bei anderen Personalentscheidungen wie Beförderungen. Man muss wissen, dass es solche Prozesse gibt, und mit unseren Erkenntnissen können wir entsprechend sensibilisieren. Allerdings ist eine ganz starke Implikation unserer Grundlagenforschung zu Stereotypen auch, dass man die Verantwortung für eine faire Entscheidung von den Schultern des Individuums und deren Intuition wegnehmen und in Strukturen und Prozesse überführen muss.
Wenn man sich nur darauf verlässt, dass die Leute die automatischen Prozesse selber erkennen und vermeiden, können sie sich sogar noch verstärken. Es geht daher nicht darum, die Gedankenpolizei anzuschalten und sich selbst auf faire Gedanken zu kontrollieren. Vielmehr muss es unterstützende Prozesse geben, etwa indem in Bewerbungsmappen nur relevante Informationen enthalten sind und irrelevante Informationen, die Eindrücke verzerren könnten, wie das Alter und der Name, zu Anfang geschwärzt sind. Auch klare Vorbereitung und Kriterien für Vorstellungsgespräche sind sehr hilfreich. Nur so kann man möglichst individuelle Beurteilungen gewährleisten.
Der Forschungsbereich
Die Forschung zu Personenwahrnehmung und Eindrucksbildung anhand von Verhalten am Arbeitsbereich Sozialpsychologie der Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaft, die unter anderem im Rahmen der Promotion von Jana Mangels erfolgt, wird durch finanzielle Projektförderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt und hat zusätzlich Fördermittel durch die Landesforschungsförderung der Stadt Hamburg erhalten. Die Promotion von Jana Mangels wird mit einem Promotionsstipendium der Hans-Böckler-Stiftung gefördert.
Forschen und Verstehen
In den acht Fakultäten der Universität Hamburg forschen rund 6.200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auch viele Studierende wenden oft bereits im Studium ihr neu erworbenes Wissen in der Praxis an. Die Reihe „Forschen und Verstehen“ gibt einen Einblick in die große Vielfalt der Forschungslandschaft und stellt einzelne Projekt genauer vor. Fragen und Anregungen können gerne an die Newsroom-Redaktion(newsroom"AT"uni-hamburg.de) gesendet werden.


